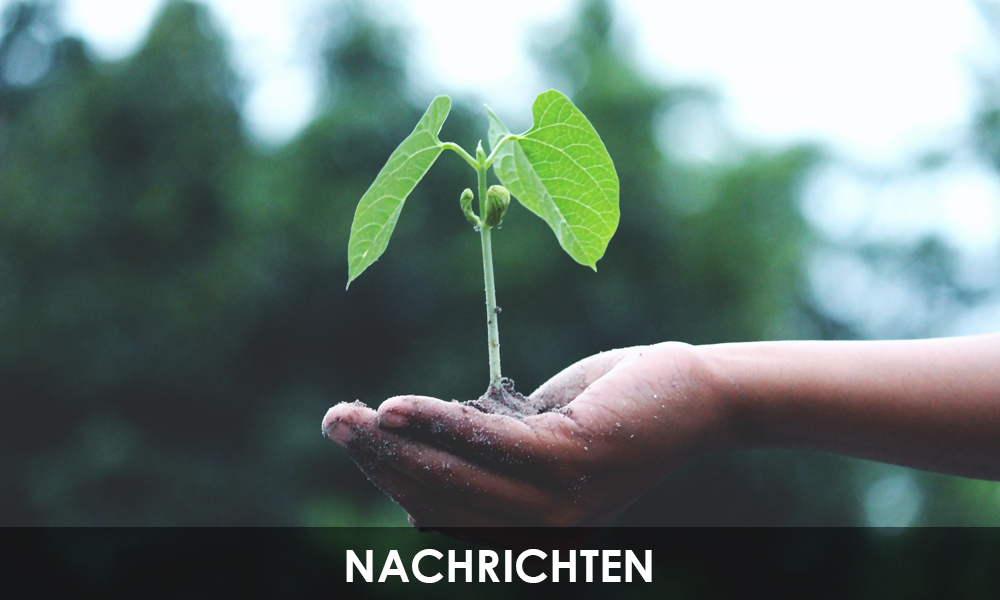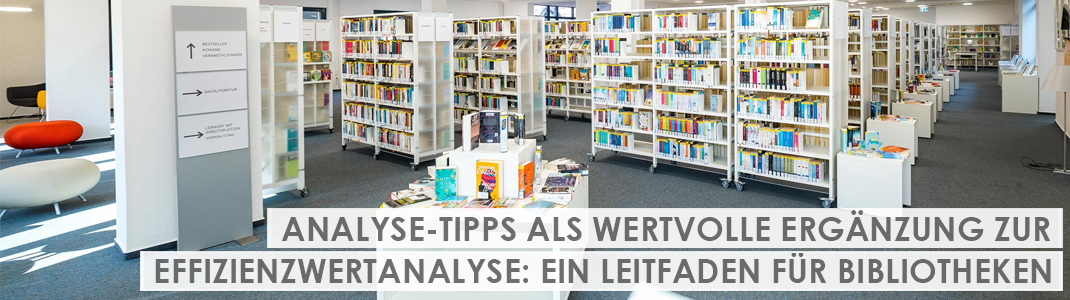Weil das Open Library Angebot der Stadtbibliothek Duisburg an drei Standorten so gut angenommen wird, sollen bald alle Duisburger Bibliotheken sieben Tage die Woche, (fast) rund um die Uhr öffnen! Mehr Informationen auf dieser Website: https://www.waz.de/…/sonntags-in-die-bibliothek-neue…
Archiv des Monats “August 2024”
Köln: KI-Kiosk im Eingangsbereich der Zentralbibliothek
Die Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Köln hat ein neues Highlight. Seit Kurzem steht direkt im Eingangsbereich der Zentralbibliothek der »KI-Kiosk« – ein für alle zugängliches und kostenfrei nutzbares KI-Terminal. Am Rechner können Besucher/-innen ohne Anmeldung ganz niederschwellig KI ausprobieren – und zwar die Textgenerierung mit ChatGPT und Bildgenerierung mit DALL-E3. Mehr Informationen auf dieser Website:
Digitaler Stammtisch „Zwei Jahre ChatGPT in der Bibliothek – Was machen wir damit?“ / 11.09.24
Seit zwei Jahren besteht die Möglichkeit, mit ChatGPT, anderen Chatbots und KI-Tools zur Bilderstellung, zu experimentieren. Nun soll im digitalen Stammtisch des dbv Bilanz gezogen und ein Erfahrungsaustausch stattfinden. Wie beeinflusst Chat GPT die Arbeit? Werden Angebote mit oder zu KI realisiert, und wie werden diese angenommen? Der Austausch über Erfahrungen und Ideen ist ausdrücklich erwünscht.
Unter dem Motto „Gemeinsam ist man weniger allein“ bietet der digitale Stammtisch Raum für Fragen, Vernetzung, gegenseitige Unterstützung und Austausch.
Kathrin Joswig, freie Medienpädagogin aus Hamburg, moderiert den Stammtisch und steht mit Rat und Tat zur Seite.
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Anmeldung bitte per E-Mail an: medienbildung@bibliotheksverband.de.
Weitere Informationen auf der Website des dbv: https://netzwerk-bibliothek.de/de_DE/termin/digitaler-stammtisch-zwei-jahre-chat-gpt-i.17793054?
Fördermittel für Projekte der digitalen Leseförderung: Neue Ausschreibung / 01.09.24
Der dbv startet für sein Förderprogramm „Gemeinsam Digital! Kreativ mit Medien” eine nächste Ausschreibung: Vom 01.09. bis zum 31.10.2024 können interessierte Bibliotheken und andere Einrichtungen Anträge für Projekte zur digitalen Leseförderung für Kinder und Jugendliche mit erschwerten Bildungszugängen beantragen.
Mehr Informationen auf dieser Website: https://www.bibliotheksverband.de/gemeinsam-digital-kreativ-mit-medien
Analyse-Tipps als wertvolle Ergänzung zur Effizienzwertanalyse: Ein Leitfaden für Bibliotheken
Die Effizienzwertanalyse ist ein unverzichtbares Werkzeug für Bibliotheken, um ihre Bestände optimal an den Bedürfnissen und Interessen ihrer Nutzer*innen auszurichten. Durch die systematische Erfassung und Analyse von Ausleih- und Bestandsdaten können Bibliotheken die Effizienz einzelner Bestandsgruppen bewerten und fundierte Entscheidungen zur Bestandsentwicklung treffen. Diese Methode ermöglicht es, sowohl Überbestände als auch Lücken im Sortiment zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Die Fachstelle setzt im Rahmen ihrer Strategieentwicklungsprogramme auf eine Methode, bei der die statistische Auswertung der Daten um sogenannte spezifische Aktionsbeschreibungen ergänzt wird. Diese bieten praxisnahe Empfehlungen, die über die rein quantitative Analyse hinausgehen. Sie unterstützen Bibliotheken dabei, auch qualitative Aspekte wie Medienpräsentation, Aktualität und Zielgruppenrelevanz zu berücksichtigen. Dadurch wird die Effizienzwertanalyse zu einem umfassenden Werkzeug, das Bibliotheken in ihrer strategischen Bestandsplanung unterstützt.
Ziel der Effizienzwertanalyse
Das Ziel der Effizienzwertanalyse ist es, anhand von Kennziffern den Aufbau der einzelnen Bestandsgruppen passgenau an der Nachfrage auszurichten. Dafür werden Bestandszahlen der jeweiligen Bestandsgruppe sowie des Gesamtbestandes mit den Ausleihzahlen ins Verhältnis gesetzt. Auf diese Weise lässt sich erkennen, in welchen Gruppen Handlungsbedarf besteht. Gleichzeitig lassen sich Konsequenzen für die künftige Verteilung des Medienetats ableiten.
Vorbereitung der Effizienzwertanalyse
Grundsätzlich gehört zur Pflege des Medienbestandes auch die Aussonderung von beschädigten bzw. nicht mehr genutzten Beständen. Beschädigte Medien werden i.d.R. weniger ausgeliehen und verursachen schlechte Effizienzwerte. Gleiches gilt für Medien, die über einen längeren Zeitraum nicht mehr ausgeliehen werden. Deshalb sollten mithilfe von Null-Listen (seit mindestens einem Jahr nicht ausgeliehene Medien) mindestens alle zwei Jahre die Bestände bereinigt werden. Spätestens im Vorfeld einer Effizienzwertanalyse empfiehlt es sich, den Bestand zu bereinigen.
Ausführung und Zeitrahmen
Um einen Trend zu erfassen und evtl. Besonderheiten in einzelnen Jahren zu erkennen, empfehlen wir eine jährliche Durchführung der Effizienzwertanalyse. Für die Entscheidungsfindung sollte jeweils ein Zeitraum von drei Jahren in den Blick genommen werden. So können auch Veränderungen bei der Bestandsnutzung beispielsweise durch eine neue Medienpräsentation oder eine neue Anschaffungspolitik überprüft werden. Besonders vor Neueinrichtungsprojekten, der Einführung von RFID-Verbuchung o.ä. sollte eine Bereinigung des Bestands und die Überprüfung der Erwerbungsstrategie mithilfe der Effizienzwertanalyse erfolgen.
Tabellenvorlage
Eine Auswertung ist in Form einer Exceltabelle am einfachsten umzusetzen. Die folgende Tabelle wurde in unserer Fortbildung „Den roten Faden finden – wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“ bereits erfolgreich eingesetzt und steht zum Download zur Verfügung:

Zu beachten ist, dass nur physische Medien und deren Ausleihen in die Effizienzwertanalyse einfließen (DBS-Fragen 13 und 14.1). E-Medien können nicht mit einbezogen werden.
Die Effizienzwertanalyse ist unabhängig von der Art der Aufstellung des Bestandes zu nutzen (z.B. Allgemeine Systematik für Bibliotheken, Interessenskreise). Nach Bedarf können die Mediengruppen weiter untergliedert werden oder um weitere Gruppen wie zum Beispiel jahreszeitliche Literatur ergänzt werden.
Ggf. muss die Tabelle an die Systematik Ihrer Bibliothek angepasst werden. Zum Schutz vor Fehlern sollten die hinterlegten Formeln aber nicht verändert werden.
In der Tabelle hinterlegte Formeln:
– Ausleihe einer Sachgruppe x 100 / Gesamtausleihe = %-Anteil an der Gesamtausleihe
– Bestand einer Sachgruppe x 100 / Gesamtbestand = %-Anteil am Gesamtbestand
– Ausleihen / Bestand = Umsatz
– Ausleihanteil / Bestandsanteil = Effizienz
In Bibliothekssystemen sollten die Zentrale und jede Stadtteilbibliothek eine eigene Effizienzwertanalyse erstellen. Den Effizienzwert aller Standorte zu addieren ist nicht zu empfehlen. Ein direkter Vergleich zwischen Stadtteilbibliotheken ist möglich, sollte aber immer alle Faktoren (Lage, Barrierefreiheit, Zielgruppen, Öffnungszeiten etc.) berücksichtigen.
Nach Eintragen der Ausleih- und Bestandszahlen für jede Bestandsgruppe werden der %-Anteil an der Gesamtausleihe, der %-Anteil am Gesamtbestand, die Effizienz und der Umsatz automatisch anhand der hinterlegten Formeln berechnet.
Der Idealwert für die Effizienz liegt bei 1,0. In diesem Fall ist der Anteil der Bestandsgruppe am Gesamtbestand und ihr Anteil an der Gesamtausleihe identisch. Da dies nur selten der Fall ist, hat sich als Faustregel für die Bewertung des Ergebnisses in der Praxis folgende Einordnung bewährt:
- Effizienz unter 0,8: zu viel Bestand bzw. Nachfrage ist zu gering
- Effizienz über 1,2: zu wenig Bestand bzw. Nachfrage ist zu groß
Tipps für die Ergebnisanalyse
Nach vorliegen der Effizienzwerte folgt die Analysephase. Für eine bessere Ergebnisbewertung wurde diese Tabelle um drei Prüfverfahren, sogenannte Aktionsbeschreibungen, ergänzt. Diese werden in der o.g. Tabelle automatisiert angezeigt:
„Analysieren und erweitern“ (Der Bestand ist im Verhältnis zur Nutzung zu klein): Die hohe Nutzung der Mediengruppe bestätigt die Wirksamkeit der aktuellen Erwerbungsstrategie, dennoch ist das bestehende Angebot derzeit nicht ausreichend, um die hohe Nachfrage zu decken. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Bestandsgruppe in den folgenden Jahren zwingend weiter ausgebaut werden muss. Denn damit verbunden sind Auswirkungen auf den verfügbaren Etat für andere Bestandsgruppen, da der Gesamtetat i.d.R. nicht erhöht wird. Darüber hinaus ergeben sich Konsequenzen für die Bestandspräsentation. Falls neue Medien untergebracht werden müssen, könnte es erforderlich sein, auf die Frontalpräsentation zu verzichten oder zusätzliche Regale aufzustellen. Dies könnte jedoch zu einer weniger ansprechenden Präsentation der Medien führen, was sich möglicherweise negativ auf die Ausleihzahlen auswirken würde. Es empfiehlt sich daher, die Untergruppen der Bestandsgruppe genauer zu analysieren, um Ausleihschwerpunkte zu identifizieren und zunächst gezielt diese Bereiche auszubauen.
„OK“ (Bestandsgröße und Ausleihzahlen stehen in einem ausgewogen Verhältnis): Die Erwerbungsstrategie kann weiterverfolgt werden. An den Werbemaßnahmen und der Medienpräsentation muss nicht zwingend etwas verändert werden.
„Prüfen“ (Der Bestand ist im Verhältnis zur Nutzung zu groß): In diesem Fall empfehlen wir die Prüfung folgender Punkte:
- Präsentation und Standort der Bestandsgruppe prüfen: Ist die Bestandsgruppe im Raum nicht sichtbar oder schwer zugänglich? Finden sich die Nutzer*innen in der Bibliothek nicht ohne Hilfe zurecht und benötigen häufig die Unterstützung der Mitarbeitenden? Ist das Regal zu voll und keine Frontalpräsentation möglich? Ist das Leitsystem aussagekräftig?
- Passen die Zielgruppen der Bibliothek zur Bestandsgruppe? Hier kann ein Blick ins Bibliothekskonzept hilfreich sein! Evtl. trifft die Bestandsgruppe nicht die Interessen der Nutze*innen? Vielleicht sind die Öffnungszeiten für potentiell Interessierte ein Hindernis? Gibt es bessere Alternativangebote im Umkreis?
- Werbung: Ist nicht bekannt, dass die Bibliothek über dieses Angebot verfügt? Wird der Bestand ausreichend beworben? Bspw. durch Veranstaltungen zum Thema. Ist der Bestand im OPAC leicht zu finden? Barrieren wie Bestandslisten für Sonderbestände anstelle von Katalogeinträgen sind evtl. eine Erklärung.
- Aktualität der Medien: Eine große Anzahl veralteter Medien in einer Bestandsgruppe erweckt den Eindruck, dass keine aktuellen Medien vorhanden sind. In diesem Fall sollten optisch und inhaltlich veraltete Medien konsequent aussortiert werden. Gleichzeitig sollte der Fokus auf einer ansprechenden Frontalpräsentation der aktuellsten Medien liegen.
- Medienart prüfen: Ist die Medienart noch aktuell und relevant für die Zielgruppe? Beispielsweise verlieren Hörbücher auf CDs für Kinder zunehmend an Bedeutung, seit es Streaming-Angebote und die beliebten Toniefiguren/Hörfiguren gibt.
Effizienzwertanalyse am Beispiel einer Kleinstadtbibliothek
Als Beispiel zeigen wir die Effizienzwertanalyse einer Kleinstadtbibliothek aus NRW. Wegen eines bevorstehenden Umzugs in den nächsten Jahren plant das Bibliotheksteam eine Neukonzeption und will daher auch den Bestand überarbeiten.

In diesem Beispiel ist die Ausleihquote der Sachliteratur gering. Da es sich um eine Kleinstadt handelt und auch nach dem Umzug keine zusätzliche Fläche zur Verfügung stehen wird, sollte das Team sorgfältig prüfen, welche Bestandsgruppen künftig beibehalten werden. Auch zur Verbesserung der Bestandspräsentation sollte das Team über eine Bestandsreduzierung nachdenken. Aktuell ist eine Frontalpräsentation mangels Platz in den Regalen nicht möglich.
Lokale Besonderheiten
Gerade für den Aufbau eines attraktiven Sachbuchangebotes ist es hilfreich, die spezifischen lokalen Interessengruppen zu kennen. Welche Vereine gibt es vor Ort, welche Themen werden in der Öffentlichkeit diskutiert? Welche inhaltlichen Schwerpunkte stehen im Fokus der Kommunalpolitik? Eine Bibliothek muss nicht zu jedem Sachgebiet einen ausgebauten Bestand anbieten, aber auf lokale Bedarfe reagieren. In diesem Beispiel weist die Gruppe „Te – Technik“ eine außergewöhnlich hohe Nutzung und einen guten Umsatz auf. Dies sollte bei der weiteren Bestandsplanung berücksichtigt werden. Auf diese Weise wird nach und nach ein auf das Einzugsgebiet zugeschnittenes Bestandsprofil entwickelt.
Optimierung durch Makulieren
In unserem Beispiel werden die Bestandsgruppen „Re – Religion“, „Ph – Philosophie“ oder „Li – Literaturkunde“ kaum oder gar nicht nachgefragt. Wenn die angebotenen Medien aktuell und gut präsentiert und trotzdem nicht genutzt werden, sollte man in Erwägung ziehen, diese Bestandsgruppen künftig nicht mehr anzubieten. Der frei gewordene Regalplatz kann für eine bessere Präsentation anderer Bestandsgruppen genutzt werden. Beispielsweise könnte man testen, ob die Gruppen „Pr – Praxis-Ratgeber“, „Pä – Pädagogik“ und „Bi – Biografien“ durch eine bessere Frontalpräsentation der Medien höhere Effizienzwerte erzielen können. Im folgenden Jahr kann man die Wirkung der getroffenen Maßnahmen mittels der Effizienzwertanalyse überprüfen und auf diese Weise das Bestandsprofil weiter schärfen.
Sonderfall „Zeitschriften“
Die Mediengruppe „Zeitschriften“ sollte gesondert betrachtet werden. Hier kann die Aktionsbeschreibung „prüfen“ lauten, da die Ausleihe eher gering ist. In Bibliotheken mit hoher Aufenthaltsqualität, die zum Beispiel ein Lesecafé haben, kann die Vor-Ort-Nutzung von Zeitschriften jedoch hoch sein. In diesem Fall sollte die Nutzung der Zeitschriften in den Aufenthaltsbereichen beobachtet werden. Auf unsere Beispielbibliothek trifft dies nicht zu. Hier ist die Nutzung überdurchschnittlich hoch (Effizienzwert 2,66), obwohl nur wenige Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Überprüfung alter Medientypen
Ähnlich wie bei Sachbüchern sollte auch bei „alten“ Medientypen wie Loseblattsammlungen, CDs und teilweise auch DVDs geprüft werden, ob sie den Bestand noch sinnvoll ergänzen. In unserem Beispiel könnten sie zugunsten von Konsolenspielen und Tonies/Hörfiguren aus dem Bestand genommen werden.
Bedeutung von untergeordneten Bestandsgruppen
Prüfhinweise bzw. Aktionsbeschreibungen für eine gesamte Bestandsgruppe können lediglich einen allgemeinen Trend anzeigen. Um fundierte Bestandsentscheidungen treffen zu können, sollte die Nutzung der zugehörigen Untergruppen detailliert analysiert werden. In unserem Beispiel lautet die Aktionsbeschreibung für die Gesamtgruppe „Non-Books“ „OK“, jedoch sollten die untergeordneten Mediengruppen für die Entscheidungsfindung einzeln überprüft werden.
Bei einer so großen Gruppe wie die der Romane, die in keine weiteren Untergruppen aufgeteilt ist, muss die weitere Analyse auf Ebene der Einzelmedien durchgeführt werden. In unserem Fall ist der Bestand im Verhältnis zur Nutzung zu groß. Ein möglicher Ansatz wäre die Aussonderung anhand einer Null-Liste sowie die Aussonderung von beschädigten Medien.
Fazit: Die Effizienzwertanalyse ist eine wichtige Grundlage für strategische Entscheidungen in Bibliotheken
Die Effizienzwertanalyse ist ein wertvolles Instrument zur Optimierung des Bestandsmanagements in Bibliotheken. Sie bietet eine objektive Grundlage, um die Effizienz von Bestandsgruppen zu bewerten und strategische Entscheidungen zu treffen. Durch regelmäßige Analysen können Bibliotheken den Aufbau ihrer Bestände besser an der Nachfrage ausrichten, Ressourcen effizienter einsetzen und ihre Angebote gezielt weiterentwickeln.
Die Entscheidungen sollten aber nicht nur auf Basis der Nutzungszahlen getroffen werden. Auch sogenannte „bibliothekspolitische Entscheidungen“, möglichst auf der Grundlage des Bibliothekskonzeptes, sollten in die Entscheidungsfindung mit einfließen. So kann beispielsweise die Heimatliteratur auch bei geringen Ausleihquoten weiter im Angebot bleiben, da die Bibliothek die Dokumentation der örtlichen Geschichte als zentrale Funktion festgelegt hat.
Die Effizienzwertanalyse ist besonders bei strukturellen Veränderungen, wie Umzügen oder Neumöblierungen, unverzichtbar. Sie hilft, veraltete oder wenig nachgefragte Medien zu erkennen und gegebenenfalls auszusortieren. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, den verbleibenden Bestand attraktiv und aktuell zu präsentieren.
Sie haben Fragen zur Effizienzwertanalyse? Dann sprechen Sie uns gerne an.
KulturPass: Kommunikationsmaterial für Bibliotheken und Verlängerung 2025
Seit dem 01.01.2024 kann das Budget des KulturPasses der BKM auch für eine Jahresmitgliedschaft in einer Bibliothek genutzt werden. Auf der Webseite des KulturPasses stehen jetzt branchenspezifische Werbematerialien wie Plakatmotive, Sharepics und Videoclips zur Bewerbung von Bibliotheksangeboten zum Download bereit. Laut BKM ist eine Fortsetzung des KulturPasses für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Motive stehen auf dieser Webseite zur Verfügung https://www.kulturpass.de/ueber-den-kulturpass
DBS: Vorab-Fragebogen Öffentliche Bibliotheken für das Berichtsjahr 2024 veröffentlicht
Das HBZ hat den Vorab-Fragebogen für das Berichtsjahr 2024 im Service-Wiki veröffentlicht. Hier finden Sie auch eine komplette Auflistung der neuen, geänderten und entfallenen Fragen.
Neu:
- 38.3 Erläuterung zu Kapitel 10 Nutzung virtueller Angebote: Hier wird die Nutzung von virtuellen Angeboten (38) gezählt. Dies können einzelne Aufrufe von Zeitungsartikeln, Datenbankeinträgen, Video- oder Audiostreams etc. sein. Zur Erfassung dieser „ausleihähnlichen Nutzungsvorgänge“ (AN) steht der AN-Rechner zur Verfügung. Es dürfen nur die Angebote aus einer für das jeweilige Berichtsjahr aktuell geltenden Liste erfasst werden. Diese Liste sowie der AN- Rechner und eine Anleitung zur Ermittlung der einzelnen Messgrößen sind im DBS-Wiki hinterlegt (siehe: https://service-wiki.hbz-nrw.de/x/lwCYPg). Diese Zahl geht NICHT in die Gesamtsumme unter (14) ein.
Entfällt: –
Geänderte Fragen:
- 7.1 Jahresöffnungsstunden für Open Library (servicefreie Zeit): Diese Frage bezieht sich nicht auf Frage 7. Hier sind alle Öffnungszeiten gemeint, in denen kein Personal vorhanden ist, das bibliotheksspezifische Dienstleistungen erbringt
- 34 E-Medien im eigenen Bestand: Eigener E-Medien-Bestand sind digitale Einzelmedien – E-Books, E-Journals, E-Audio u.a. (nicht Datenbanken oder Plattformen), die die Bibliothek eigenständig (nicht im Verbund) lizenziert hat und auf die sie ihren Nutzern zeitlich befristet den Zugriff ermöglicht. Derzeit sind dies die über Onleihe und Overdrive lizenzierten Einzelmedien. Mit anderen Bibliotheken geteilter E-Medien-Bestand (z.B. gemeinsamer Bestand aus einem Onleihe-Verbund) wird in (34.1)erfasst. Zur Erhebung weiterer virtueller Angebote siehe (38).
- 34.1 E-Medien im Verbund: Diese Frage ist keine Teilmenge von Frage 34. Gezählt wird hier die Anzahl der E-Medien (Lizenzen), die über einen Verbund mehreren Bibliotheken gemeinsam zur Verfügung stehen (z.B. Onleihe-Verbund). Diese Zahl geht NICHT in die Gesamtsummen unter (13) und (15) ein.
- 35 E-Medien – Entleihungen: Hier sind ausschließlich die Entleihungen der in (34) und (34.1) erfassten Bestände anzugeben. Die Nutzung der in (38) erfassten weiteren virtuellen Angebote wird in (38.3) erhoben.
- 38 Virtuelle Angebote: Hier werden die von der Bibliothek lizenzierten virtuellen Angebote gezählt, die als Plattform, (Streaming-) Dienst oder Datenbank eines externen Anbieters zur Nutzung bereitgestellt werden. Es wird nur das Angebot an sich gezählt, nicht einzelne Zeitschriften, Artikel, Audios, Filme etc. Bei Angeboten, die die Lizenzierung von Teilpaketen (z.B. Munzinger: Munzinger-Personen, Munzinger-Länder, Munzinger-Duden etc.) ermöglichen, werden die lizenzierten Teilmodule einzeln gezählt. Nicht zu zählen sind hier die Angebote aus (34) und (34.1), von der Bibliothek selbst erstellte Angebote, Sammlungen oder elektronische Schulungsprogramme sowie Web-OPAC und andere Suchportale.
- 40 Laufende Zeitungs- und Zeitschriftenabos in elektronischer Form: Diese Angabe erfragt die Anzahl der Zeitschriftenabonnements in virtueller Form im Berichtsjahr (am 31.12.). Zeitschriften werden nach der Anzahl der Abonnements erfasst, unabhängig von der Anzahl der Titel. Mehrfachexemplare des gleichen Titels werden als mehrere Abonnements gezählt. Zeitschriften und Zeitungen, die in Parallelausgaben (gedruckt und elektronisch) lokal angeboten werden, sind einmal in (39) und einmal in (40) zu zählen. Zeitschriftentitel im Bundle sind als ein Abonnement zu zählen. Jede Bibliothek eines E- Medien-Verbundes gibt die Gesamtzahl der virtuellen Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements an.
- 77 Auszubildende (Personen): Hierzu zählen ausschließlich Personen mit Ausbildungsvertrag in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder dualen (praxisbegleitenden oder praxisintegrierten) Studium. Praktikanten sind hier nicht zu zählen.
Eingabe gesperrt: 2, 3, 4 (diese werden automatisiert aus der Adressdatenverwaltung der Bibliotheken gefüllt), 12.1 (wird aus der Messung zur Zählung der virtuellen Besuche gefüllt, s. https://service-wiki.hbz-nrw.de/x/FoA7Fg)
Perspektivenpapier „Öffentliche Bibliotheken in Sachsen 2030“
Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus hat ein Perspektivenpapier entwickelt, um die Öffentlichen Bibliotheken bei ihrer notwendigen Weiterentwicklung zu unterstützen. Es definiert insgesamt 10 Handlungsfelder und enthält zu diesen konkreten Empfehlungen. Es richtet sich sowohl an die Öffentliche Bibliotheken als auch an die Städte und Gemeinden als deren Träger sowie an die zur SLUB gehörende Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken. Wesentliche Ergebnisse des Papiers sind, dass es einer ausgewogenen Mischung von stationären, mobilen und vor allem digitalen Informations- und Medienangeboten bedarf, um eine flächendeckende Informationsversorgung für alle Generationen zu gewährleisten. Weiterhin braucht es lokale und regionale Kooperationen, um Ressourcen optimal und effizient einzusetzen.
Das Papier kann auf dieser Webseite heruntergeladen werden: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1078624
Förderprogramm: „Modelle für Kulturinstitutionen von morgen“
Kulturinstitutionen in deutschen Großstädten stehen vor einer Vielzahl komplexer, kulturpolitischer Zukunftsaufgaben, die durch sich derzeit überlagernde Krisen entstehen. Das bundesweite Programm „Modelle für Kulturinstitutionen von morgen“ (AT) lädt Kultureinrichtungen wie Museen, Theater, Bibliotheken und Konzerthäuser und Kommunen ein, trotz dieser Herausforderungen einen Raum für grundlegende Innovationen zu schaffen und sich dem Impuls zu widersetzen, auf Bekanntes und Vertrautes zurückzugreifen. Mit dem Programm stellt die Kulturstiftung des Bundes die Mittel zur Verfügung, um Überlegungen zu neuen Modellen zu ermöglichen: etwa für interkommunale Kooperationen oder experimentelle Nutzungskonzepte für Kulturorte. Das Programm beruht auf der Annahme, dass Kulturinstitutionen in zehn Jahren nur dann eine breite gesellschaftliche Unterstützung genießen werden, wenn sie noch stärker als Gemeingut wahrgenommen werden.
In der Orientierungsphase in den Jahren 2024 bis 2027 fördert die Kulturstiftung des Bundes zunächst die Entwicklung von bis zu fünfzig institutionellen Innovationskonzepten in deutschen Großstädten mit je 50.000 Euro. Zudem umfasst diese Phase Beratungs- und Vernetzungsangebote, Recherche- und Inspirationsreisen zu modellhaften europäischen Kulturorten erweitern den Blick international. Dafür steht ein Gesamtbudget in Höhe von bis zu 4,6 Millionen Euro zur Verfügung. Eine Fortsetzung des Programms ist ab 2027 geplant, damit ausgewählte Vorhaben anschließend realisiert werden können.
Anträge sind möglich, sobald die Fördergrundsätze mit den Antragsvoraussetzungen voraussichtlich Anfang 2025 auf der Seite der Kulturstiftung des Bundes veröffentlicht wurden.
Mehr Informationen auf dieser Website: https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/transformation_und_zukunft/detail/modelle_fuer_kulturinstitutionen_von_morgen_at.html
Düsseldorf: Verlängerte Öffnungszeiten in der Zentralbibliothek und zwei Stadtteilbüchereien
Ab Oktober soll die Stadtteilbücherei in Unterbach auch samstags und sonntags geöffnet werden. In den zusätzlichen 13 Öffnungsstunden sollen die Nutzenden mithilfe von Open Library Technik und ihrem Bibliotheksausweis Zutritt erhalten. Die Statteilbücherei Eller soll ab November zehn weitere Öffnungsstunden durch die Einführung eines Schließ- und Aufsichtsdienstes hinzugewinnen. Die Öffnungszeiten der Zentralbibliothek sollen sich sonntags zukünftig um zwei Stunden erweitern, sodass sie von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet ist.
Mehr Informationen auf dieser Website: https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-buechereien-in-eller-und-unterbach-oeffnen-demnaechst-auch-am-sonntag_aid-115837639