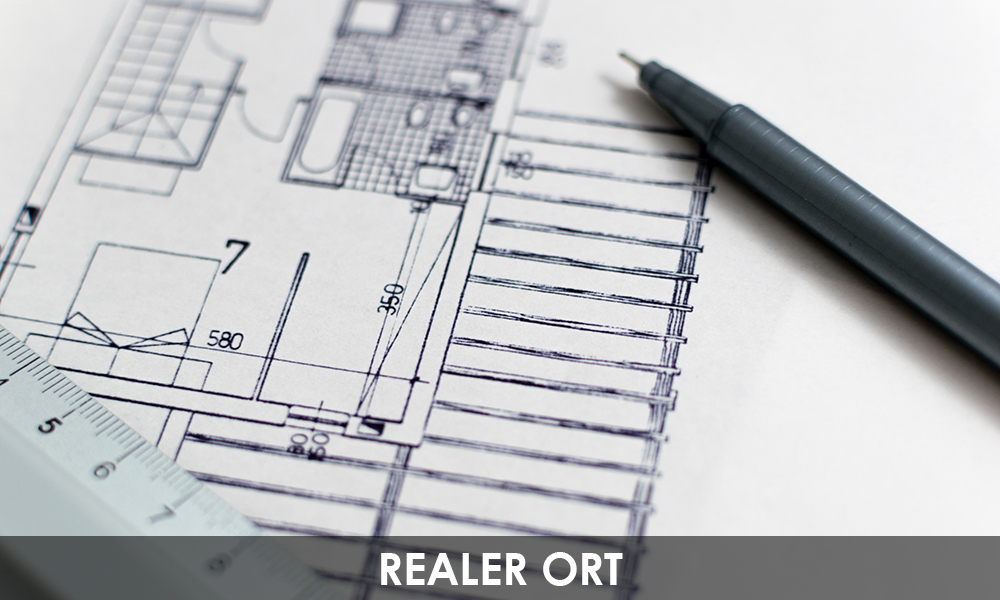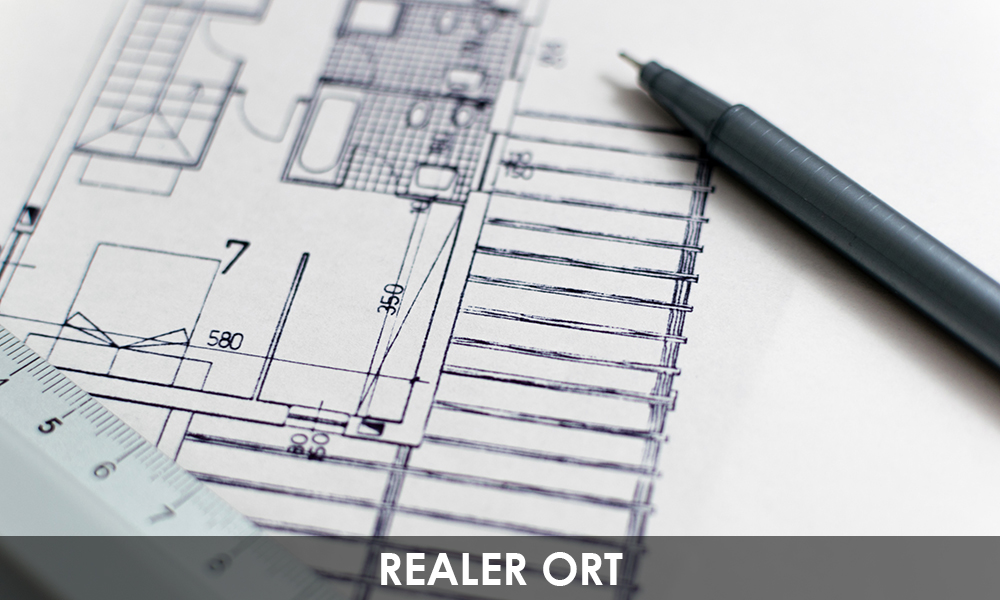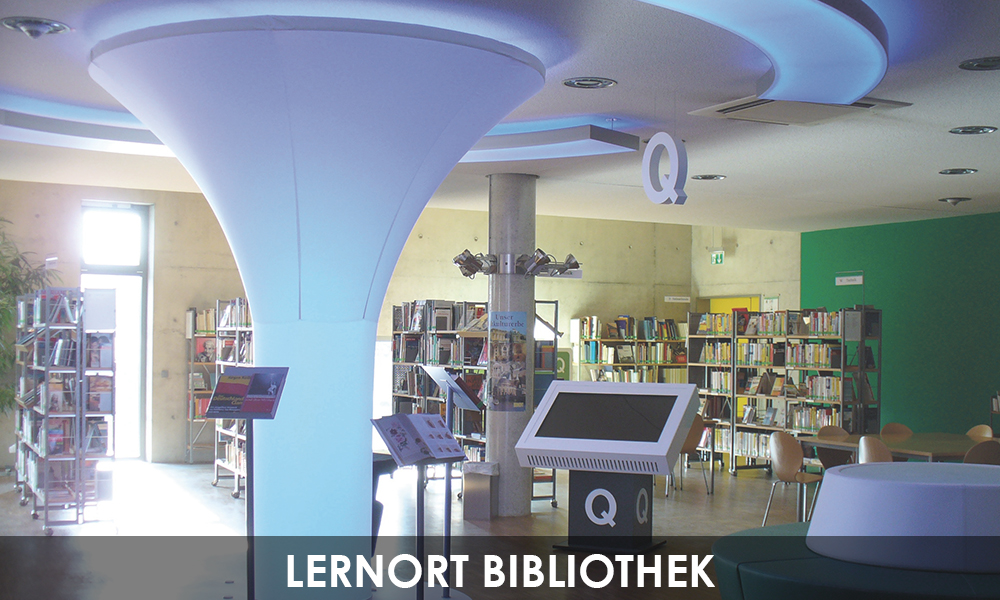Um die oben gestellte Frage zu beantworten, sollte ich für diejenigen von Ihnen, die ihn nicht kennen, den Begriff Hygge erklären.
Hygge beschreibt die dänische Glücksphilosophie, welche die Nation 2016 auf Platz 1 des World Happiness Report brachte und bedeutet so viel wie Gemütlichkeit. Es geht bei Hygge nicht um Gegenständlichkeiten und Dinge, sondern vielmehr um Atmosphäre und Erleben. Beides Dinge, die derzeit besonders wichtig sind für Öffentliche Bibliotheken. Ganz egal, ob man den Ort nutzt, um Zeit mit lieben Menschen zu verbringen oder sich alleine mit einem guten Buch in einen Sessel zu kuscheln. Hygge hat viele Seiten! Wollen wir nicht auch ein bisschen glücklicher sein, so wie die Menschen aus dem Norden? Und können wir dieses Lebensgefühl in unsere Bibliotheken holen und diese hyggelig machen?
Es gibt einige wichtige Aspekte bei Hygge, die man meiner Meinung in den Räumlichkeiten einer Bibliothek umsetzen kann.
Punkt 1: Licht
Maik Wiking beschreibt in seinem Buch „Hygge- eine Lebensgefühl, das einfach glücklich macht“, dass die einfachste Art und Weise Hygge zu erzeugen sei, eine Kerze anzuzünden. Aber nicht nur Kerzen, welche sich schwer für öffentliche Einrichtungen eignen, sondern auch künstliches Licht, sorgen für eine hyggelige Atmosphäre. Wichtig dabei ist die Lichttemperatur, welche nicht zu hoch sein darf. Unter grellen Neonröhren ist es nicht besonders gemütlich. Natürlich muss in einer Bibliothek für eine ausreichende Beleuchtung gesorgt werden. Aber in Bereichen, welche zum Klönen einladen sollen, oder dort, wo sich der Nutzer einfach gemütlich in einem Ohrensessel zurücklehnt, darf es gerne etwas gedämpfter und wärmer sein. Auch die Gestaltung der Leuchten ist entscheidend. Die Dänen haben einen Faible für Designerlampen. Diese werden strategisch eingesetzt, um kleine Lichtinseln zu schaffen.
Punkt 2: Hyggekrog

Ein kuscheliger Platz in der Raumecke kann wunderbar als Hyggekrog dienen.
Hyggekrog bezeichnet eine besonders gemütliche Ecke, in die man sich gerne zurückzieht und sich dort aufhält: Eine gepolsterte Fensterbank mit Kissen und Decke, ein gemütlicher Sessel mit einem Beistelltischchen mit dem Blick nach draußen… Hauptsache hyggelig.
Punkt 3: Gemeinschaft
Natürlich kann man auch alleine Hygge erleben, aber nicht umsonst verbringen 60 % der Europäer mindestens einen Abend pro Woche mit Familie, Freunden oder auch Kollegen. Bei den hyggenden Dänen sind es sogar 78 %. Wir sind soziale Wesen und menschliche Beziehungen sind ein Schlüsselelement zu unserem Glück. Schaffen wir also Orte, an denen man eine schöne Zeit mit anderen verbringen und schöne Dinge erleben kann.
Punkt 4: Nähe zur Natur

Auf/in diesen Vogelnestern, können die Kinder in der Stadtbibliothek Hanau lesen.
Wir lieben die Natur und die Nähe zu ihr wirkt entspannend auf uns. Einfachheit, Langsamkeit und Rustikalität entschleunigen abseits vom urbanen Alltag. Wie also bringen wir die Natur in die Bibliothek? Gegenstände und Möbel aus Holz geben uns das Gefühl der Natur näher zu sein. Auch Felle und alles was aus dem Wald kommt, wie Zweige, Wurzeln und Blätter erschaffen eine entsprechende Atmosphäre. Vielleicht können wir Formen und Farben dieser Elemente ja an der einen oder anderen Stelle in den Räumen aufgreifen.
Punkt 5: Bücher
Laut Maik Wiking gehört eine Pause mit einem guten Buch definitiv zur Vorstellung von Hygge. Welches Buch spielt dabei keine Rolle, je nach Geschmack. Und Bücher finden wir in unseren Bibliotheken ja wohl zu genüge. Also ab mit dem Lieblingsbuch in die Hyggekrog.
Punkt 6: Essen und Trinken (Heiße Getränke, Kuchen und Teilchen)

Bei einem leckeren Heißgetränk und einem schönen Stück Kuchen können wir entspannen. Nur keine Flecken in die Medien machen …. 🙂
Kuchen und süßes Gebäck machen uns glücklich. Die Mischung aus Zucker und Fetten kurbelt die Insulinproduktion an, was dazu führt, dass das Glückhormon Serotonin produziert wird. Dieser Botenstoff vermittelt uns Glückgefühle, Zufriedenheit und Entspannung, was dabei hilft ein Stück Stress aus unserem Alltag zu nehmen. Alles in Maßen natürlich. Ebenso entspannen wir uns bei einer schöner Tasse Kaffee, Tee oder heißer Schokolade. Heiße Getränke vermitteln uns ein tröstliches, wohliges Gefühl.
Ein Lesecafé in dem man sich gemütlich in einem schönen Sessel mit einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen zurücklehnen kann, dabei in einer Zeitschrift blätternd oder in ein nettes Gespräch vertieft kann also ein richtig hyggeliger Ort in einer Bibliothek sein.
Natürlich gehören noch weitere Punkte bei Hygge dazu. Viele Elemente sind gut dafür geeignet Hygge in die Bibliothek zu bringen. Dass das Thema Hygge in den Medien verbreitet wurde mag zwar schon ein bis zwei Jahre zurück liegen, aber fragen Sie doch mal einen Dänen, ob Hygge jemals „out“ sein kann. Ein bisschen mehr Gemütlichkeit und Glücklichsein können wir doch alle gut gebrauchen, immer! Und wenn wir über Orte sprechen, die Hygge für Jeden bieten, warum sprechen wir dann nicht einfach auch über Bibliotheken?