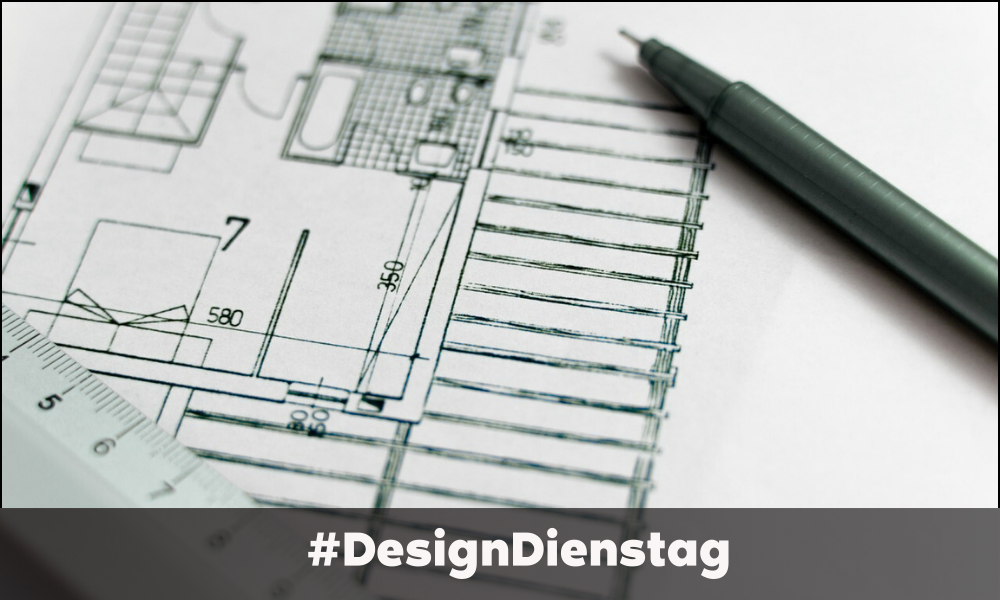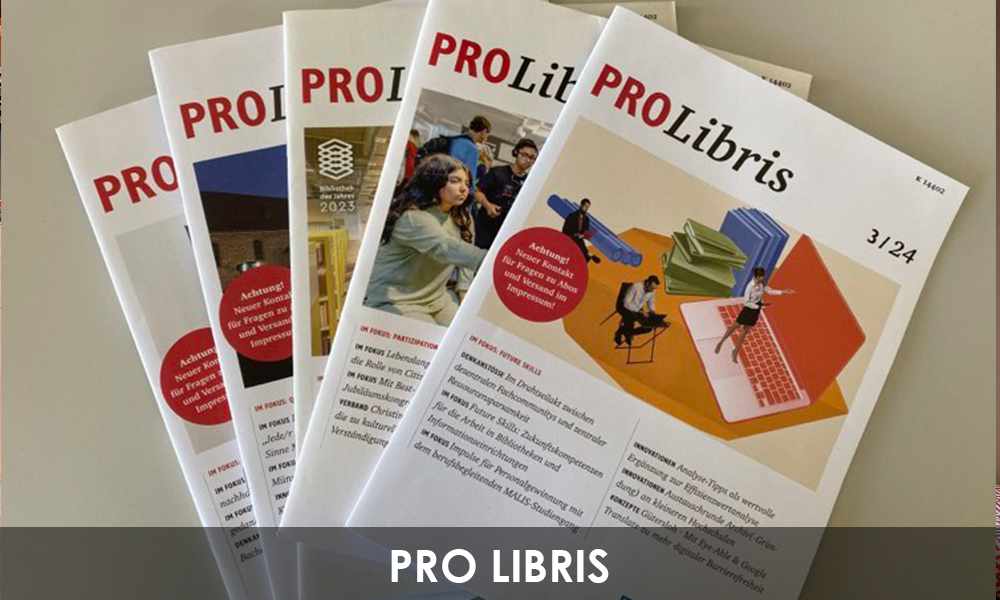Willkommen zu unserem neuen #DesignDienstag. In dieser Serie nimmt euch unsere Innenarchitektin Anja Thimm mit in die Welt der Bibliotheksgestaltung. Sie zeigt, wie aus gut geplanten Räumen lebendige und einladende Orte werden, in denen man sich gerne aufhält. Ob Eingangsbereich, Kinder- oder Jugendbibliothek: Jede Zone erfüllt eine eigene Aufgabe und braucht ihre ganz eigene Atmosphäre. Zum Auftakt schauen wir uns den Eingangsbereich an. Denn der erste Eindruck zählt – auch in der Bibliothek.
Orientierung und Raumstruktur
Wenn ich eine Bibliothek betrete, sehe ich mir (logisch ;)) als Erstes immer den Eingangsbereich an. Nicht aus Neugier, sondern weil hier ganz viel entschieden wird. Der Eingang ist die Visitenkarte der Bibliothek. In den ersten Sekunden entsteht ein Eindruck, der bleibt. Fühle ich mich willkommen? Verstehe ich sofort, wo ich hinmuss? Oder bin ich erst einmal mit mir und dem Raum beschäftigt?
Gute Gestaltung bedeutet hier vor allem, Funktion und Atmosphäre zusammenzubringen. Besucherinnen und Besucher sollten ohne großes Nachdenken zur Informationstheke, zur Garderobe oder zur Medienverbuchung finden. Klare Wege, eine logische Zonierung, gut lesbare Beschilderung und eine offene Raumstruktur helfen enorm. Auch Licht spielt dabei eine große Rolle: Helle, gut ausgeleuchtete Bereiche geben Sicherheit und erleichtern die Orientierung.
Barrierefreiheit und Inklusion
Orientierung hört aber nicht bei Wegführung und Schildern auf. Für mich gehört Barrierefreiheit immer ganz selbstverständlich zur Gestaltung dazu. Rutschhemmende Böden, automatische Türen und ausreichend Bewegungsflächen für Rollstühle sind keine Extras, sondern Grundlagen.
Sehr bewährt haben sich taktile Bodenleitsysteme, die Menschen mit Seheinschränkungen direkt zur Informationstheke führen. Ergänzend können digitale Hilfen wie akustische Wegweiser oder niedrig platzierte Touchscreens den Zugang weiter erleichtern. Wichtig ist dabei immer, die Technik so einzusetzen, dass sie unterstützt und nicht überfordert.
Ein schönes Beispiel dafür ist die Stadtteilbibliothek Oberhausen-Sterkrade: Hier führt ein taktiles Leitsystem sicher zur Theke, die zudem barrierefrei unterfahrbar gestaltet ist.

Funktionale Möblierung
Ein zentrales Thema im Eingangsbereich ist natürlich die Möblierung. Die Informationstheke ist meist das Herzstück. Sie muss für die Mitarbeitenden ergonomisch funktionieren und gleichzeitig niedrigere Bereiche für barrierefreie Kommunikation bieten.
Auch Selbstverbuchungs- und Rückgabesysteme sollten gut platziert sein. Ideal ist es, wenn sie vom Thekenbereich aus einsehbar bleiben. Die Medienrückgabe sollte möglichst direkt nach dem Betreten erreichbar sein. Eine zusätzliche Außenrückgabe schafft Flexibilität und wird von vielen Nutzenden sehr geschätzt.
Gleichzeitig bietet der Eingangsbereich großes Potenzial für mehr als reine Servicefunktionen. Niedrige Regale oder spezielle Präsentationsmöbel eignen sich hervorragend für Neuerscheinungen oder aktuelle Themen. Auch Zeitschriftenbereiche, kleine Lesecafés oder andere Kommunikationszonen funktionieren hier gut. Es ist ein lebendiger Bereich, in dem keine absolute Ruhe nötig ist und der durch große Fenster oft auch nach außen wirkt.
Bei Sitzmöbeln achte ich besonders auf Komfort, Pflegeleichtigkeit und Robustheit. Der Eingangsbereich ist stark frequentiert und genau das muss man den Möbeln auch zugestehen.
Lichtgestaltung
Ein oft unterschätzter Faktor ist die Beleuchtung. Dabei hat Licht enormen Einfluss auf Orientierung und Aufenthaltsqualität. Eine gute Lichtplanung nutzt Tageslicht, vermeidet Blendung und setzt gezielt Akzente. So entsteht eine freundliche Atmosphäre, die Besucherinnen und Besucher ganz automatisch weiter in die Bibliothek hineinzieht.
Beispiele aus NRW
Ein gut gestalteter Eingangsbereich ist somit weit mehr als eine Durchgangszone: Er schafft Orientierung und legt den Grundstein für ein positives Nutzungserlebnis. Dass es viele gute Lösungen gibt, zeigen zahlreiche Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen. Hier ein paar Beispiele:
Stadtbibliothek Bergheim
Hier empfangen wechselnde Farben und mehrsprachige Begrüßungen die Besucher*innen. Der Verbuchungsbereich liegt direkt neben dem Eingang und ist von der Servicetheke aus gut im Blick.
Stadtbibliothek Brühl
Die Bibliothek in Brühl teilt sich das Gebäude mit dem Rathaus. Das gemeinsame Foyer dient als Rückgabeort für Medien. Auf jeder Etage sorgt eine Theke für Orientierung und ist Anlaufstelle für Besucher.*innen.
Stadtteilbibliothek Essen-Huttrop
In Essen-Huttrop liegt die Theke direkt im Eingangsbereich und dient sowohl als Informationstheke als auch als Café. Der Verbuchungsbereich ist dank farbiger Leuchtschrift sofort sichtbar.
Stadtbibliothek Kamp-Lintfort
In Kamp-Lintfort befindet sich das Lesecafé im Eingangsbereich der Bibliothek. Der eigentliche Empfangsbereich mit Informationstheke befindet sich etwas weiter hinten, abgetrennt durch den Open-Library-Bereich.
Stadtbibliothek Langenfeld
In Langenfeld gelangen die Besucher*innen beim Betreten der Bibliothek direkt zur Informationstheke, die gleichzeitig als Theke für das gegenüberliegende Lesecafé genutzt wird. Der Selbstverbuchungsbereich ist vor der Theke angeordnet und wurde in die Wand sowie das angrenzende „Superregal“ integriert.
Zentralbibliothek Mönchengladbach
Der Eingangsbereich in der Zentralbibliothek Mönchengladbach ist ein offenes Foyer über zwei Geschosse, das auch für Veranstaltungen genutzt wird. Neben Theke, Verbuchungsbereich und Garderobe gibt es auch ein Lesecafé auf der Ebene. Ein großer digitaler Infoscreen informiert die Besucher direkt beim Betreten.
Stadtteilbibliothek Oberhausen-Sterkrade
Im Windfang in Oberhausen-Sterkrade gibt es E-Ladeplätze für Fahrräder. Besucher*innen werden über eine mehrsprachige Beschriftung auf der Glasschiebetür informiert. Ein taktiles Bodenleitsystem führt zur Theke, die barrierefrei unterfahrbar gestaltet ist.
Stadtbibliothek Velbert
Die Bibliothek in Velbert ist Teil des Forum Velbert und wird über ein gemeinsames Foyer betreten. Direkt beim Eingang der Bibliothek liegt der Verbuchungsbereich, ergänzt durch ansprechend gestaltete Präsentationsmöbel. Die Theke befindet sich nach einem kleinen Durchgang am Rand der offenen Fläche, die Sitzplätze und die Belletristik beherbergt.


Autorin
Anja Thimm studierte Innenarchitektur an der Hochschule Trier. Nach ihrem Abschluss und einem Ausflug in die Welt der Büroplanung gehört sie seit 2016 zum Team der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW und berät Bibliotheken zu den Themen Bau und Einrichtung. Ebenfalls seit 2016 ist sie Mitglied der Facharbeitsgruppe Bau und Einrichtung der Fachstellenkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland.