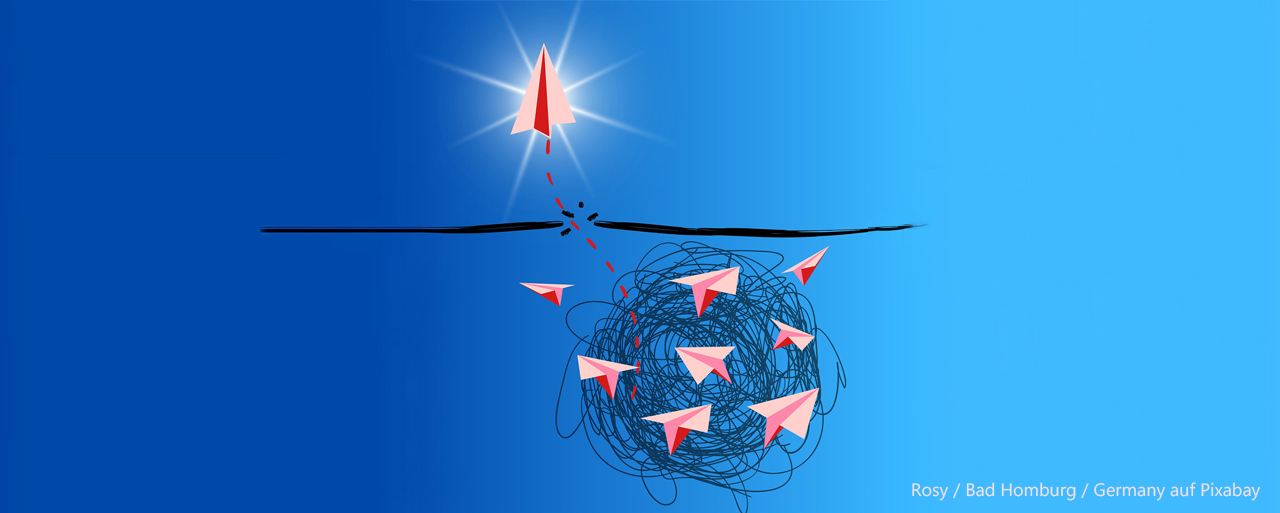Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an KI-Tools, die den Arbeitsalltag erleichtern oder kreative Prozesse unterstützen können – auch in Bibliotheken. Um einen praktischen Einblick zu geben, stellen wir zum Abschluss unserer KI-Reihe eines dieser Werkzeuge genauer vor: Napkin AI. Das Tool wandelt einfache Texteingaben in anschauliche Infografiken, Diagramme und visuelle Darstellungen um – ganz ohne Designkenntnisse. Unsere Kollegin Silke Keßler hat Napkin AI ausprobiert und zeigt in diesem Beitrag, wie Napkin AI funktioniert, wo es im Bibliothekskontext sinnvoll eingesetzt werden kann und welche Chancen und Grenzen die Nutzung mit sich bringt.
Napkin AI ist ein KI-gestütztes Tool, das aus Texteingaben Infografiken, Diagramme und visuelle Darstellungen erstellt. Ideen, Daten oder Konzepte können mit Napkin AI anschaulich visualisiert werden. Designkenntnisse der Nutzenden sind dafür nicht erforderlich.
Neben der Grafikerstellung kann Napkin auch erklärende Texte oder Zusammenfassungen zu den Visualisierungen generieren. Die erstellten Grafiken lassen sich individuell anpassen – etwa durch eigene Farben, Schriftarten oder Layouts. Zudem können mehrere Personen gemeinsam an einer Grafik arbeiten.
Für die Nutzung ist eine Anmeldung per E-Mail oder über Google erforderlich.
Vor- und Nachteile des Tools
Für die Ermittlung der Vor- und Nachteile von Napkin habe ich das Tool selbst befragt. Den dafür verwendeten Prompt habe ich bewusst sehr einfach gehalten:
Hallo Napkin! Bitte zeige mir die Vor- und Nachteile in der Nutzung von Napkin AI auf. Die Zielgruppe sind Bibliotheksmitarbeitende in Öffentlichen Bibliotheken NRW. Bitte zeige mir auch auf, wo Bibliotheksmitarbeitende Napkin sinnvolleinsetzen können.
Napkin AI hat auf Basis dieses Prompts die Vor- und Nachteile ermittelt und beginnt die Auflistung mit einer kurzen Einleitung (siehe Abbildung 1). Auf der Abbildung ist zudem zu erkennen, dass das erstellte Dokument mit anderen Personen geteilt, eine neue Napkin-Anfrage direkt gestartet oder Kommentare für sich selbst beziehungsweise für Mitarbeitende hinzugefügt werden können.

(Abbildung 1)
Unter den Vorteilen stehen Effizienzsteigerung und Automatisierung, Verbesserte Benutzererfahrung, Datengestützte Entscheidungsfindung und die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

(Abbildung 2)
Linksbündig vom ausgegebenen Text ist ein Blitz auf türkisem Grund erkenntlich. Anhand eines Mausklicks kann für einzelne Passagen dann eine Grafik erstellt werden.

(Abbildung 3)
Es kann entweder die ganze Überschrift visualisiert werden oder nur Teilaspekte der Vorteile. Im linken, türkisenen Kasten kann dann aus unterschiedlichen Stilen ausgewählt werden oder unter „Customize“ individuell angepasst werden. Der Text bleibt unverändert und wird nur von der Visualisierung ergänzt.
Bei den Nachteilen (Abbildung 4) weist Napkin überraschenderweise darauf hin, dass die Kosten ein Nachteil sein könnten. Tatsächlich sind die Starter- und Professional-Pakete von Napkin bislang kostenlos. Kosten entstehen lediglich im Enterprise-Paket, das für einfache Veranstaltungsarbeiten oder kleine Präsentationen nicht erforderlich ist. Im Enterprise-Paket können beispielsweise Firmen ihr eigenes Logo und Corporate Design einbinden.

(Abbildung 4)
Jeder Output in Napkin kann in eine Grafik umgewandelt werden. Der Text im Napkin-Dokument lässt sich jederzeit bearbeiten und kann anschließend mit der überarbeiteten Version erneut visualisiert werden. Eine solche Überarbeitung ist empfehlenswert, da die KI häufig Wörter verwendet, die schwer nachvollziehbar sind. Zudem sollte die Ansprache im Prompt klar und präzise formuliert werden.
Nach der Auswahl der Art der Grafik besteht anschließend die Möglichkeit, eine konkrete Variante auszuwählen (siehe Abbildung 5).

(Abbildung 5)
Mein Fazit
Napkin ist leicht zu bedienen und bietet eine praktische Alternative zu klassischen PowerPoint-Grafiken. Gerade bei Präsentationen gilt: „Das Auge isst mit“ – Napkin AI visualisiert Inhalte anschaulich und lässt Präsentationen professioneller wirken. Zudem lässt sich das Tool nutzen, um kreative Impulse für Veranstaltungen zu gewinnen. Visualisierungen unterstützen oft das gesprochene Wort und machen zum Beispiel Zahlen leichter verständlich.
Gleichzeitig sollte stets überprüft werden, ob der Output korrekt und passend ist. Es empfiehlt sich, den generierten Text nicht unverändert zu übernehmen, sondern sicherzustellen, dass er mit dem ursprünglich eingegebenen Prompt übereinstimmt. Auch beim Hochladen von Dateien ist Vorsicht geboten: Napkin AI verarbeitet DOC-, PDF-, PPT-, HTML- oder Markdown-Dateien und wandelt deren Inhalte in Visualisierungen um. Wie genau die Daten gespeichert oder verarbeitet werden, ist jedoch nicht transparent, weshalb sensible Informationen nur eingeschränkt genutzt werden sollten.