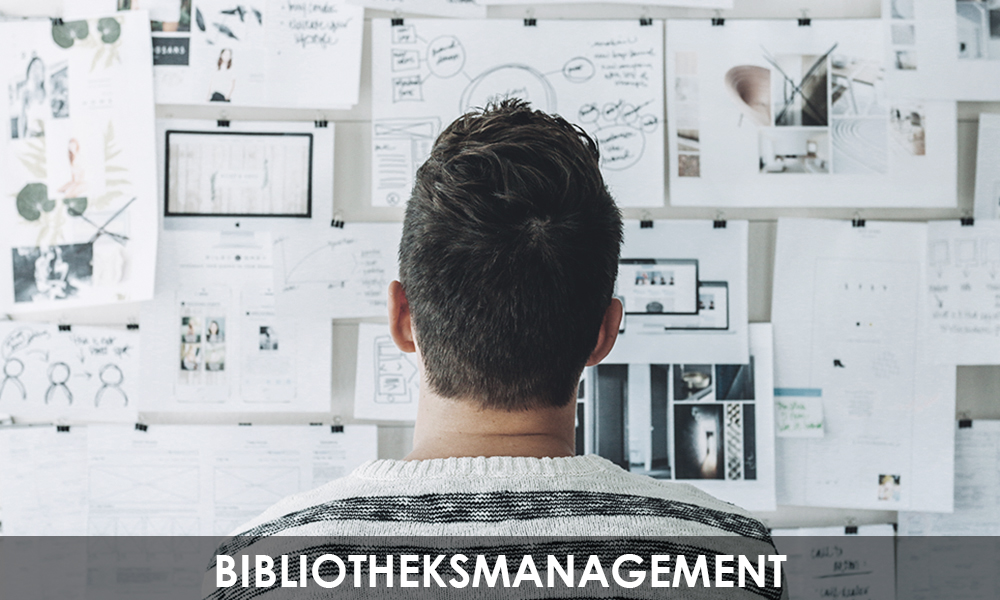2009 hat das Land NRW die Initiative „Lernort Bibliothek“ ins Leben gerufen. Mit der Abschlussveranstaltung am 15. Mai 2019 hat die Initiative ihr offizielles Ende gefunden. ProLibis hat das 10-jährige Jubiläum zum Anlass genommen, um noch einmal einen Blick zurück zu werfen. Wir freuen uns, dass wir diese Rückblicke nun auch auf unserem Blog veröffentlichen können. Die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW bedankt sich herzlich bei allen Mitstreitenden in den vergangenen 10 Jahren und natürlich bei den Autorinnen und Autoren dieser Artikel.
Von Julia Bergmann
Positives Vorbild für andere Einrichtungen
In der Entwicklung der Bibliothek als Lernort waren im Konzept zwei Hauptbausteine angelegt. Eine räumliche Umgestaltung der Bibliotheken und eine Entwicklung der digitalen Kompetenzen und Angebote der Bibliotheken als Grundlage für die Erarbeitung neuer Angebote und Services für, wie neue Kommunikationswege und Kollaborationsformen mit den Kunden. Alle teilnehmenden Bibliotheken wurden zu den Themen kollaboratives Arbeiten, Social Media, Gaming und später auch in Storytelling geschult.
Wir, das heißt Berater Christoph Deeg und die Autorin, schlugen vor, nicht zentrale thematische Schulungen für Einzelne anzubieten, sondern die Teams als Ganzes zu schulen. Dies hat die Nachhaltigkeit des Gelernten und den Transfer der erworbenen Kompetenz in neue Angebote der Bibliotheken stark gefördert.
Nun 10 Jahre später können wir sehen, dass Gaming und die dialogische Kommunikation der Bibliotheken mit ihren Kunden zum normalen Bestandteil der Arbeit in Bibliotheken geworden ist. Oft sind die Bibliotheken hier positives Vorbild für andere Verwaltungseinheiten der Städte geworden. Auf Basis der erworbenen Kompetenzen und durch die vom Programm geförderten Netzwerke war es den Bibliotheken möglich, sich selbständig in diesem Feld weiter zu entwickeln. So war dieser erste digitale Aufbruch, die neue dialogische Kommunikationsform und der kollaborative Ansatz eine gute Grundlage für weitere Entwicklungen wie Makerspaces und zielgruppengenaue Angebote innerhalb des Medienkompetenzrahmens des Landes NRW.
Somit stehen die Bibliotheken den hohen medialen und gesellschaftlichen Herausforderungen gestärkt gegenüber und können ihren Kunden Lotse und Vermittler, Partner und Plattform sein.
Für mich war das Projekt Lernort ein sehr intensives Erlebnis, mit vielen inspirierenden Momenten und Begegnungen, die ich in der Zusammenarbeit mit den Teams erleben durfte.
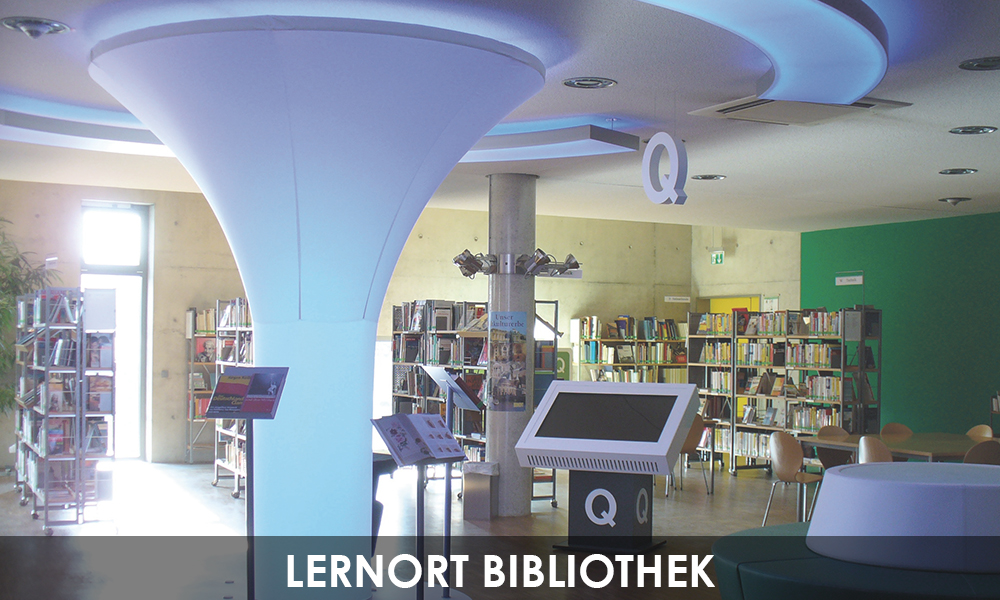




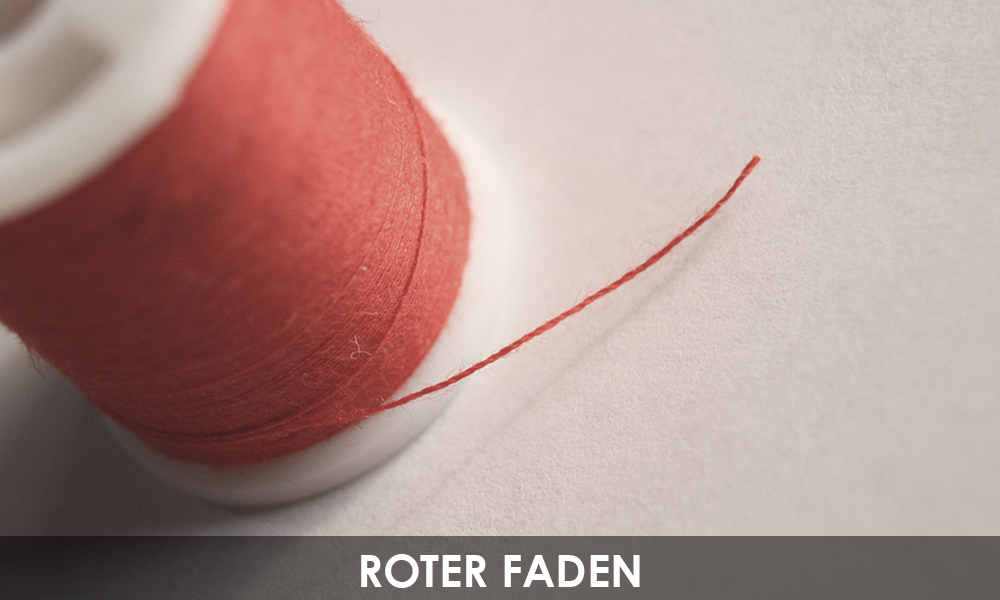
 Als Trainerin habe ich die beiden ersten Fortbildungsrunden „den roten Faden finden – wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“ der Fachstelle NRW in Kooperation mit dem ZBIW Köln begleitet. 20 kleine öffentliche Bibliotheken aus ganz NRW haben daran teilgenommen und ihr individuelles Konzept erarbeitet.
Als Trainerin habe ich die beiden ersten Fortbildungsrunden „den roten Faden finden – wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“ der Fachstelle NRW in Kooperation mit dem ZBIW Köln begleitet. 20 kleine öffentliche Bibliotheken aus ganz NRW haben daran teilgenommen und ihr individuelles Konzept erarbeitet.