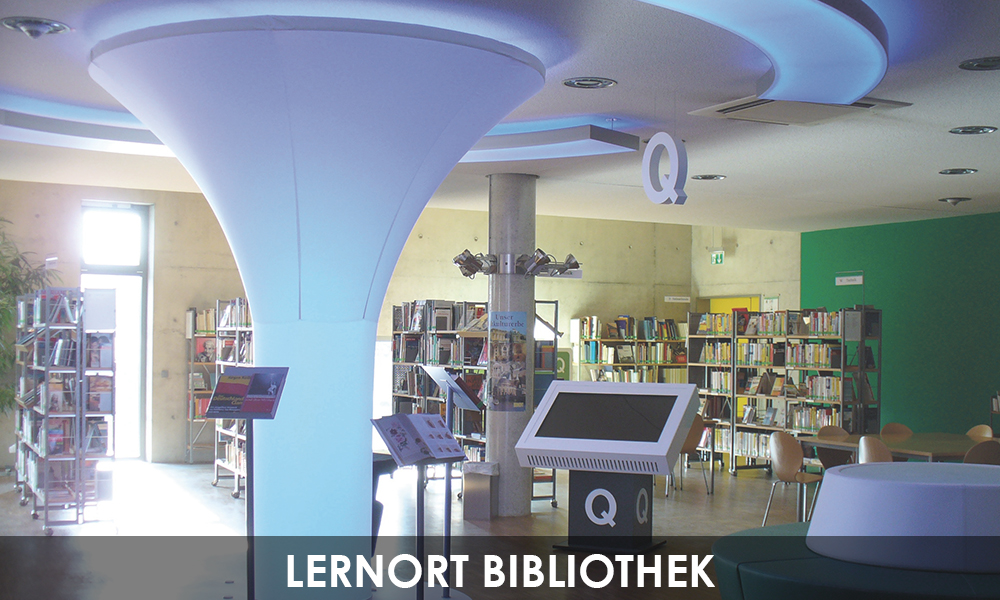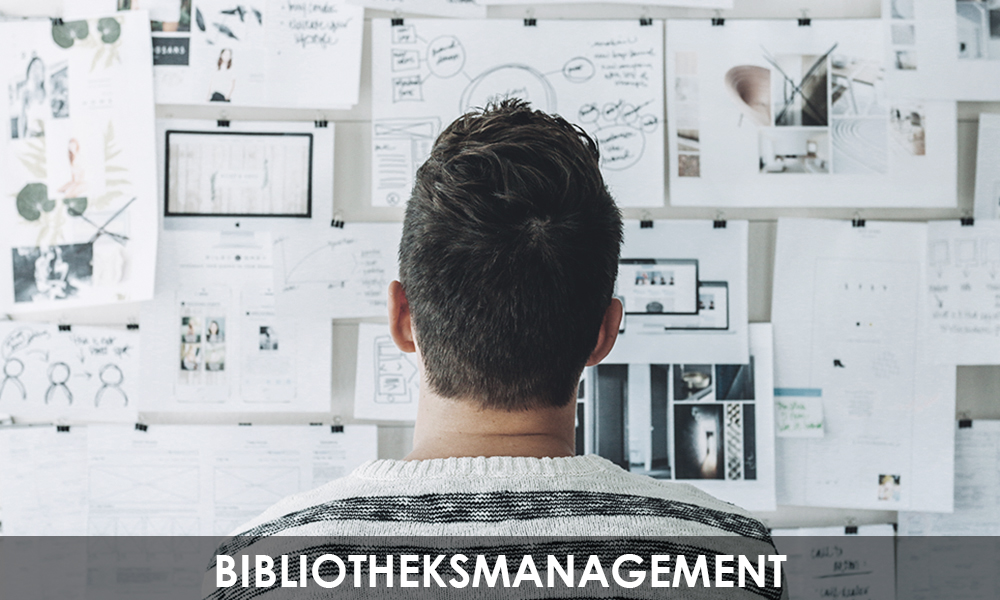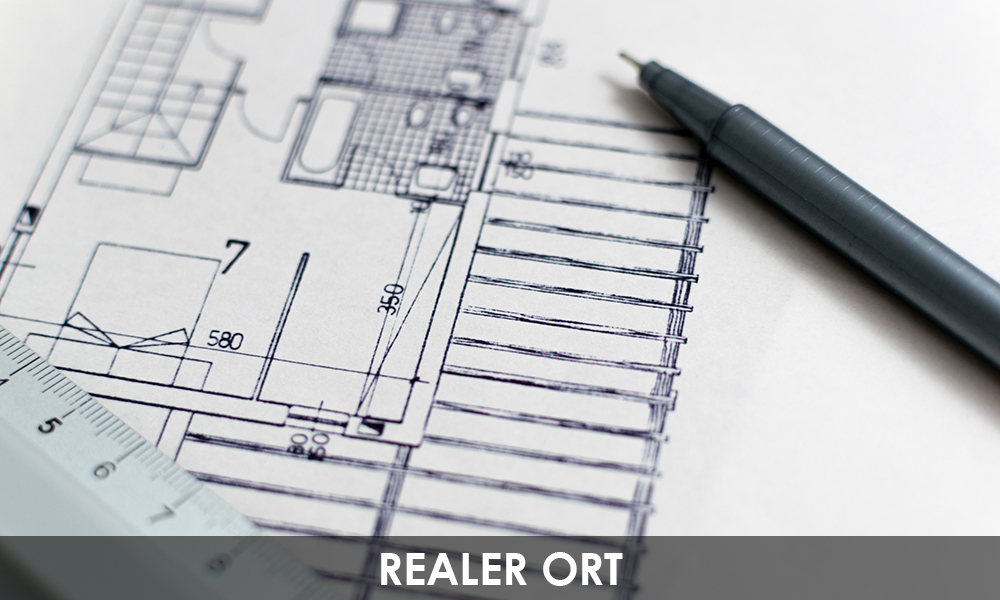Vom September 2015 bis März 2016 lief der Kurs „Netzworking – Grundlagenkurs für Bibliotheksarbeit im Social Web“ zum zweiten Mal. Der erste Kurs, der in Kooperation mit der Büchereizentrale Niedersachsen lief, fand von November 2014-Mai 2015 statt.
Es ist Zeit für uns einmal Resümee zu ziehen:
Was ist Netzworking?
Der Grundlagenkurs “NETzWorking” bietet die Möglichkeit sich Woche für Woche selbstständig die Grundlagen für die Bibliotheksarbeit im Social Web anzueignen. Sie arbeiten zeit- und ortsunabhängig, da die Aufgaben selbstständig am eigenen Rechner bearbeitet werden. Im Kursblog (www.netzworking.wordpress.com) wird wöchentlich ein Thema vorgestellt und anhand von Übungsaufgaben von den Teilnehmern bearbeitet. Die Teilnehmer dokumentieren ihre eigenen Lernergebnisse in ihrem am Kursanfang erstellten Weblog. Die Kursleiter beantworten Fragen, und begleiten die Teilnehmer durch Antworten auf ihrem Blog.
Welche Inhalte wurden behandelt?
Die einzelnen Themen sind als Module zusammengefasst. So können die einzelne Themengebiete zusammenhängend bearbeitet werden oder auch Themengebiete, die bereits bekannt sind, ausgelassen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Kurs eingestiegen werden.
Die Absolventen
Der erste Kurs lief in Kooperation mit der Büchereizentrale Niedersachen. Insgesamt waren 69 Teilnehmer aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen angemeldet, wovon 22 Teilnehmer den Kurs vollständig inkl. Teilnahmebescheinigung abgeschlossen haben.
Der zweite Kurs wurde alleine von der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW durchgeführt. Durch die Anbindung an das Förderprogramm „Digitale Kommunikation für Öffentliche Bibliotheken„ nahmen hier komplette Bibliotheksteams teil. Insgesamt waren knapp 130 Teilnehmer angemeldet, wovon 65 Teilnehmer den Kurs vollständig inkl. Teilnahmebescheinigung abgeschlossen haben.
Unsere Erfahrungen
Ein Selbstlernkurs wie NETzWorking setzt eine Menge Disziplin und Eigenmotivation voraus. Über 6 Monate die Motivation zu halten und jede Woche die Aufgaben (neben der regulären Arbeit) selbstständig zu bearbeiten ist nicht einfach. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Teilnehmer im ersten Kurs von den Kontakten im Netz besonders profitiert haben, wenn sie in kleinen Bibliotheken arbeiten und damit mehr „Hilfestellung“ von außerhalb erfahren konnten. Im zweiten Kurs war eine der Änderungen, dass ganze Bibliotheksteams am Kurs teilgenommen haben. Hier diente der Kurs plötzlich als teambildende Maßnahme. In einigen Bibliotheken wurden Aufgaben gemeinsam beantwortet, es wurde sich gegenseitig geholfen und der Kurs hat dabei mehr im Team bewegt, als die reine Aufgabenstellung. Die Teilnahme im Team hat sicherlich einige Kollegen, die von sich aus kein Interesse an diesem Themengebiet hatten, enorm herausgefordert. Hierbei war besonders am Anfang viel Widerwillen zu spüren. Auch der Ansatz des Kurses, über das Üben zu lernen und nicht nur theoretische Informationen zu bekommen, war für diesen Personenkreis sehr mit Hürden verbunden. Über die Zeit hat sich der Widerwillen in den meisten Fällen gelegt, es wurde verstanden warum man sich mit dem Themengebiet beschäftigen muss und warum das konkrete Üben auf den Plattformen so wichtig ist: denn dadurch, dass die Teilnehmer sich direkt auf den Social Media-Plattformen bewegen, und nicht auf einer abgeschirmten Kursplattform, üben Sie sofort den Umgang mit den Plattformen und können sich auch mit anderen Nutzern, die keine Teilnehmer des Kurses sind, vernetzen. Auch das Wahrnehmen, was „im Netz da draußen“ gerade passiert, war oft wichtiger als das eigene posten auf den Plattformen. Zudem entwickelten sich auf den jeweiligen Plattformen Gruppen bzw. Vernetzungen über die man Hilfe von den anderen Nutzern, den Kursleitern und anderen Teilnehmern bekommen kann.
Je nach Teilnehmerkreis wurden unterschiedliche Plattformen bevorzugt und dann eben auch mehr genutzt. Im ersten Kurs wurde zum Beispiel sehr viel über Twitter kommuniziert, während im zweiten Kurs die Nutzung vom Facebook überwog.
Unser Fazit:
So ein Selbstlernkurs hat enormes Potenzial. Durch die eigene Einteilung der Zeit kann jeder Teilnehmer sich sein Tempo und seine verfügbare Zeit einteilen. Es kann problemlos als Team-Fortbildung und als selbstständiger Lernender teilgenommen werden. Bei beiden Formen gibt es Vor- und Nachteile bei der Aufrechterhaltung der Motivation und Hilfestellungen.
Das Fazit einiger Teilnehmer des 2. Kurses: