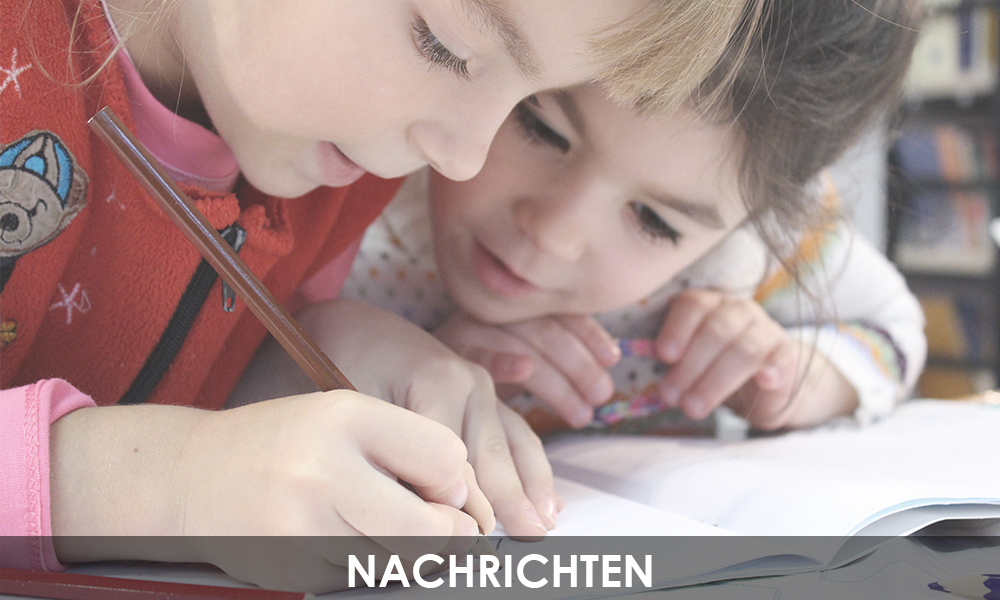Die Akademie für Leseförderung in Niedersachsen veröffentlicht regelmäßig „Praxistipps von A-Z“. Geordnet sind die Angebote nach Elementar-, Primar- und Sekundarbereich und sind in Form von Spielen, Übungen und Materialien verfügbar. Seit einigen Tagen sind neue Angebote hinzugekommen, bspw. ein neu Entwickeltes Spiel zu dem Kinderbuch „Das Schoko-Geheimnis“.
Weitere Informationen und die Praxistipps finden Sie auf der Webseite der Akademie für Leseförderung.