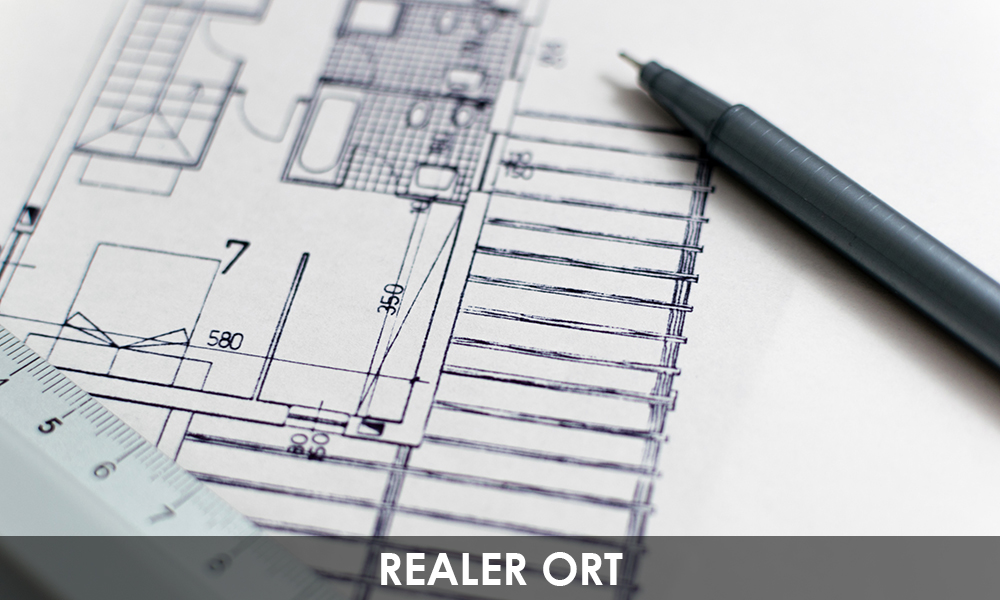Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Entwicklung Öffentlicher Bibliotheken u.a. durch die finanzielle Förderung von innovativen Projekten. Die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW stellt in lockerer Reihenfolge interessante Praxisbeispiele aus verschiedenen Förderprogrammen in Form von Gastbeiträgen auf ihrem Blog vor. Der vorliegende Beitrag stellt das Konzept der Stadtbücherei Ibbenbüren zur Einrichtung eines Makerspace und der Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für Schulen auf Grundlage des Medienpass NRW vor.Weiterlesen Makerspace meets Medienpass in der Stadtbücherei Ibbenbüren
Archiv des Monats “Februar 2018”
Spartenbericht Museen, Bibliotheken und Archive, 2017
Im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Kultusministerkonferenz wurde ein Spartenbericht mit zentralen Kennzahlen zu Museen, Bibliotheken und Archiven veröffentlicht.
Herunterladen: Spartenbericht Museen, Bibliotheken und Archive 2017 (PDF, 0,8 MB)
Quelle: Publikationen DeStatis „Spartenbericht Museen, Bibliotheken und Archive“ (zuletzt geöffnet am 07.02.2018), online verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Kultur/SpartenberichtMuseen.html
Projekt „Sprachschatz“: Sprachbildung, Mehrsprachigkeit, Medienbildung und Medienkompetenz
Das Pilotprojekt „Sprachschatz – Bibliothek und KiTa Hand in Hand“ ist im Oktober 2017 gestartet. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW und der Landesweiten Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI). In den nächsten Monaten werden verschiedene Gastbeiträge veröffentlicht, welche allen Interessierten anhand fachlichen Inputs Einblicke in das Projekt „Sprachschatz“ ermöglichen sollen. Mit dem Abschluss des Projekts in 2020 werden die Ergebnisse für den Einsatz in der Fläche aufbereitet und in Form eines Abschlussberichts veröffentlicht. In diesem Blogbeitrag gibt die LaKI einen Einblick in die Entstehung und Bedeutung des Pilotprojekts und beleuchtet die Rolle der Kommunalen Integrationszentren darin.
Sprachbildung, Mehrsprachigkeit, Medienbildung und Medienkompetenz – diese Begriffe sind inzwischen im Bereich der Frühen Bildung nicht mehr wegzudenken. Die entscheidenden Weichen zur Entwicklung von Sprachkompetenz werden in den ersten Lebensjahren gestellt. Die kontinuierliche Förderung der sprachlichen Entwicklung ist daher wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen Bildung in den KiTas in NRW. Damit diese Förderung fortlaufend und stimmig erfolgt, muss die Arbeit der verschiedenen Akteure auf unterschiedlichen Ebenen abgestimmt, die Energien gebündelt werden. Dadurch entstehen Synergieffekte, Doppelstrukturen werden gemieden, das macht die gemeinsame Arbeit effektiver.
Hierfür war eine Kooperation zwischen Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI), mit einem Team aus Kolleginnen aus unterschiedlichen Bereichen wie Schulentwicklung, Integration als Querschnittaufgabe und Frühe Bildung – Mehrsprachigkeit und diversitätsbewusste Entwicklung im Elementar- und Primarbereich und der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW der erste Schritt. Die logische Konsequenz war dann, sinnvolle Kooperationen auf der lokalen Ebene zu installieren. Auf dieser Weise entstand die Idee, die zu „Sprachschatz – Bibliothek und KiTa Hand in Hand“ geführt hat. Mit dem Ziel der Vermittlung von Sprachbildung und Medienkompetenz unter besonderer Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit von Familien und Kindern haben sich lokale Bündnisse aus Kitas, Bibliotheken und Kommunale Integrationszentren (KI) gebildet, die zusammen gezielt, abgestimmt und systematisch vor Ort für zweienhalb Jahren arbeiten werden.
Unser Fokus als LaKI liegt insbesondere in der Förderung der Mehrsprachigkeit, d.h. die Förderung des Deutschen sowie aller Familiensprachen der Kinder und Familien, die Zielgruppe von „Sprachschatz“ sind. Im Sinne der Anerkennung und Wertschätzung dieser lebensweltlichen Mehrsprachigkeit gehört es zu den Aufgaben aller im Projekt involvierten Akteure, die Mehrsprachigkeit der Familien und der Kinder wertzuschätzen und gezielt zu fördern. Der reflektierte, gekonnte Umgang mit digitalen Medien kann – und wird – diesen Prozess sinnvoll unterstützen. Im Rahmen von „Sprachschatz“ finden daher bedarfsorientierte Fortbildungsveranstaltungen statt, die vor Ort angeboten werden.
Wir sind überzeugt, Dank der Synergieffekte auf unterschiedlichen Ebenen die Förderung verschiedener und wesentlicher Aspekte der Frühen Bildung mit „Sprachschatz“ optimal zu unterstützen.
Ansprechpartnerin bei der LaKI:
Livia Daveri
Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI)
Frühe Bildung, Elementarbereich und Übergang Primarstufe
Telefon: 02931 82 5207; E-Mail: livia.daveri@bra.nrw.de;
Homepage: http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de
Weitere Informationen zu „Sprachschatz“:
„Sprachschatz – Bibliothek und KiTa Hand in Hand“ – 2017-2019 Auftakt zum Pilotprojekt
Ausschreibung: Sprachschatz – Bibliothek und KiTa Hand in Hand
Hamm: Zentralbibliothek bekommt einen Sicherheitsdienst
Immer wieder wurden in der Vergangenheit in der Zentralbibliothek in Hamm Bibliothekskunden als auch Bibliothekspersonal von einer pöbelnden Gruppe belästigt. Seit März letzten Jahres gibt es nun einen externen Sicherheitsdienst in der Bibliothek, der für das Sicherheitsgefühl im Gebäude sorgen soll. Die Situation hat sich seitdem entspannt und die Stadt wird den Sicherheitsdienst für mehrere Jahre ausschreiben.
Quelle: Osiewacz, Frank: „Security soll Besucher der Bücherei weiter schützen“ (29.01.2018), online verfügbar unter: https://www.wa.de/hamm/hamm-mitte-ort370531/security-soll-besucher-stadtbuecherei-hamm-schuetzen-stadt-schreibt-sicherheitsdienst-9565222.html
Duisburg: Stadtteilbibliothek aus Personalmangel geschlossen
Die Beecker Stadtteilbibliothek ist nun seit mehreren Wochen auf Grund Personalmangels geschlossen und es sei noch nicht geklärt, ob oder wann die Bibliothek wieder geöffnet wird. Insbesondere die Integrationsfunktion der Bibliothek wird von den Bürgern und der Kommune geschätzt.
Quelle: Balke, Christian: „Beecker Bibliothek wegen Personalmangels seit Wochen zu“ (02.02.2018), online verfügbar unter: https://www.waz.de/staedte/duisburg/nord/stadtteilbibliothek-in-beeck-wegen-personalmangels-seit-wochen-zu-id213305943.html
Onlinekurs „Bloggen für Vereine“
Der kostenlose Onlinekurs „Bloggen für Vereine“ erklärt Schritt für Schritt, wie man einen eigenen Blog erstellt und pflegt. Die Kursteilnehmer können das Arbeitstempo selbstbestimmen und werden durch erklärende Videos unterstützt. Der Onlinekurs wurde von zwei Masterstudentinnen aus Tübing erstellt.
Quelle: Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Tübingen – Newsletter Öffentliche Bibliotheken Nr. 11 2017
Dossier „Lesen mit Kinderwebseiten“
Kinder und Jugendliche nutzen das Internet regelmäßig. Und auch hier ist die Leseförderung wichtig. Die Stiftung Lesen hat ein Dossier zum Lesen mit Kinderwebseiten herausgebracht, das Informationen zum Thema sowie Einsatzmöglichkeiten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie eine Liste mit empfehlenswerten Webseiten beinhaltet.
Quelle: Stiftung Lesen – „Dossier: Lesen mit Kinderwebseiten“ (zuletzt aufgerufen am 05.02.2018), online verfügbar unter: https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/digitales/kinderwebseiten#Lesef%C3%B6rderung
Dinslaken: Gutenberg trifft E-Book
Das Projekt „Gutenberg trifft E-Book“ der Stadtbibliothek Dinslaken wurde im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 als offizieller Beitrag unter dem Leitthema „Europa: Gelebtes Erbe“ aufgenommen. Damit ist es das erste und bisher einzige Projekt einer Öffentlichen Bibliothek in Deutschland, welches auf der Seite verzeichnet wird.
Das Projekt widmet sich dem Thema Buchdruck und -malerei. In Workshops macht die Bibliothek den Herstellungsprozess von Büchern in verschiedenen Epochen erlebbar. Man schreibt z.B. am Pult bei Kerzenschein mit Gänsefeder und Tinte oder bedient alte Druckerpressen.
Alle Projetkte im Rahmen des Europäischen Kulturerberjahrs finden Sie unter: https://sharingheritage.de/projekte/
Die Veranstaltung auf Facebook „Gutenberg trifft E-Book – Mitmachausstellung in der Bibliothek“
Quelle: Europäisches Kulturjahr 2018 – Sharing Heritage „Gutenberg trifft E-Book“ (zuletzt aufgerufen am 07.02.2018), online verfügbar unter: https://sharingheritage.de/projekte/gutenberg-trifft-e-book/
Anleitung zum Basteln und Making
Auf der Website der Jungen Tüftler gibt es eine Sammlung von Ideen rund um die Themen Making und Tüfteln. Es gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tipps zum Herunterladen und ausprobieren. Die Anleitungen stehen unter einer OER-Lizenz und können bedenkenlos verteilt, verändert und weiterverarbeitet werden.
Quelle: Website Junge Tüftler – „Lostüfteln“ (zuletzt aufgerufen am 05.02.2018), online verfügbar unter: http://junge-tueftler.de/lostuefteln/
Barrierefreie Bibliothek –Räumlichkeiten für Alle (Teil 2)
Dass zu einer barrierefreien Bibliothek mehr gehört, als die Zugänglichkeit verschiedener Geschosse mit Hilfe eines Fahrstuhls, ist Ihnen Allen spätestens seit meinem letzten Beitrag zu diesem Thema sicherlich klar geworden. Und natürlich sind neben dem Zugang zu einem barrierefreien Raum auch entsprechende Angebote, Medien und Veranstaltungen wichtig. Doch um diese nutzen zu können muss ich nun einmal zunächst in die Räumlichkeiten gelangen. Daher möchte ich Ihnen noch ein bisschen detaillierter näher bringen, was alles dazu gehört eine Bibliothek (und natürlich auch andere öffentliche Einrichtungen) physisch barrierefrei zu gestalten.
Der Gebäudeeingang: Zugang für alle
Starten wir zunächst einmal vor dem Gebäude: Ist der Zugang zu Ihrer Bibliothek leicht auffindbar, z.B. durch eine kontrastreiche Gestaltung der Eingangstür und eine ausreichende Beleuchtung? Ist der Eingang ebenerdig gelegen oder über eine Rampe mit dem öffentlichen Raum davor verbunden? Der Zugang zu einer öffentlichen Einrichtung muss für alle Menschen gleichermaßen nutzbar sein. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bedeutet das, dass die Zugangswege einer Mindestbreite von 1,50 m entsprechen müssen. Treppenstufen und Schwellen sind zu vermeiden. Türen öffnen sich automatisch oder benötigen zumindest einen geringen Kraftaufwand bei der Benutzung. Türöffnungen sind mindestens 90 cm breit. Um Menschen mit Seheinschränkungen den Zugang zu erleichtern, werden taktile Bodenleitsysteme verwendet, welche durch Aufmerksamkeitsfelder Eingänge „sichtbar“ machen. Auch akustische Systeme können unterstützen, indem Sie z.B. darauf aufmerksam machen, dass eine Tür gerade geöffnet ist.
Info-Theke: Nah am Eingang und taktil erreichbar
Wenn der Besucher es denn dann ins Gebäude geschafft hat, stellen sich hier die nächsten Fragen, wie eine Nutzung für jedermann möglichst einfach gestaltet werden kann. Die Informationstheke sollte nah dem Eingang zu finden sein. Auch hierhin sollte ein taktiles Bodenleitsystem führen. Mindestens ein Beratungsplatz an der Theke sollte so gestaltet sein, dass er unterfahrbar ist. Hierfür muss eine lichte Höhe von 67 cm und eine Tiefe von mindestens 30 cm gegeben sein. Die Bewegungsfläche vor der Theke muss so groß sein, dass ein Rollstuhlfahrer dort problemlos rangieren kann.


Leitsystem: Finden statt Suchen
Ein taktiler Orientierungsplan im Eingangsbereich der Bücherei hilft besonders sehbehinderten Menschen dabei, sich eine Übersicht über die Räumlichkeiten zu verschaffen. Sowohl durch erhabene Profilschrift, als auch durch Brailleschrift sind Informationen lesbar. Natürlich hilft so ein Übersichtsplan auch allen anderen Nutzern sich besser zu orientieren. Das Leitsystem einer Bibliothek ist einer der Punkte, bei dem man sich im Bereich der barrierefreien Gestaltung so richtig austoben kann. Durch die Verwendung verschiedener Farben, leicht verständlicher Sprache und von Piktogrammen wird das Auffinden der einzelnen Bereiche der Bibliothek auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen erleichtert. Die Farbgestaltung dieser Bereiche kann zum Beispiel auch in der Signatur der Medien weitergeführt werden, auch am Regal können Piktogramme der Orientierung helfen… die Möglichkeiten sind quasi unerschöpflich.
Aufzug ist nicht gleich Aufzug
Die Erreichbarkeit unterschiedlicher Geschosse, sollte neben einer Treppe, welche über beidseitig angebrachte Handläufe verfügt, auch über einen Aufzug gewährleistet werden. Vor Treppenabgängen oder -aufgängen sollten sich bei einem taktilen Leitsystem Aufmerksamkeitsfelder befinden. Ebenso hilfreich für Menschen mit Seheinschränkungen ist die kontrastreiche Markierung der Trittstufen an der Vorderkante. Und ist ein Aufzug eigentlich grundsätzlich barrierefrei? Auch hier müssen verschiedene Punkte bedacht werden, wie die Erreichbarkeit von Tasten. Um in einer erreichbaren Höhe für Rollstuhlfahrer zu sein, können Sie sich zum Beispiel auf einem horizontal angebrachten Tableau im Aufzug befinden, mit einer Mindestgröße der Tasten von 5×5 cm. Die Beschriftung sollte entsprechend groß, kontrastreich und tastbar sein. Die akustische Ansage der verschiedenen Stockwerke erleichtert sehbehinderten Menschen zusätzlich die Orientierung. Natürlich ist auch die Mindestgröße eines Fahrstuhlkorbes zu beachten. Und haben Sie sich vielleicht auch schon einmal gefragt, warum die Rückseite eines Fahrstuhles häufig verspiegelt ist? Dieser Spiegel dient keinesfalls dazu, sein Äußeres überprüfen zu können, sondern ermöglicht einem Rollstuhlfahrer der vorwärts in den Fahrstuhl gefahren ist, beim Ausstieg den Blick nach hinten, ohne sich hierfür verrenken zu müssen. Sie sehen: Aufzug ist nicht gleich Aufzug.



Regalanordnung: Abstand halten
Um die Medien in einer Bibliothek für jeden erreichbar zu präsentieren, sind natürlich auch die Breiten von Verkehrswegen und die Gestaltung von Regalen zu berücksichtigen. Allgemeine Verkehrswege sollten so breit gestaltet sein, dass ein Rollstuhlfahrer und ein Nutzer ohne Rollstuhl gut aneinander vorbei kommen. Hierfür ist eine Breite von 1,50 m von Nöten. Damit sich Rollstuhlfahrer auch problemlos zwischen den Regalen in den Bediengängen bewegen können, ist ein Regalabstand von 1,20 m Abstand einzuhalten. Dass Medien, die zu hoch oder zu weit unten im Regal stehen, nicht für Jeden zu erreichen sind, ist denke ich auch allen verständlich. Regale sollten möglichst (eventuell durch Sockelleisten) bis auf Boden geführt werden, da Sie nur dann mit einem Langstock zu ertasten sind.
Sitzmöbel und Arbeitsplätze zum Lesen, Lernen und Arbeiten
Da unsere Öffentlichen Bibliotheken auch immer mehr zu Aufenthaltsorten werden, sollten natürlich auch Sitzmöglichkeiten und Arbeitsplätze in ihrer Gestaltung verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Generell sind gleichmäßig auf der Fläche verteilte Sitzgelegenheiten angenehm für jeden Nutzer, der nicht gut zu Fuß ist.
Sitzmöbel mit Armlehnen, an denen man sich beim Aufstehen abstützen und nach oben drücken kann, sind besonders für mobilitätseingeschränkte Menschen eine Hilfe. Die Sitzfläche sollte nach Möglichkeit nicht zu tief sein, auch das erschwert das Aufstehen. Einige Tische, die zum Lesen, Lernen und Arbeiten dienen, sollten ebenso wie die Theken die Möglichkeit der Unterfahrbarkeit aufweisen, sprich bestimmte Maße berücksichtigen. Die Oberflächen von Möbeln sollten blendfrei gestaltet werden. Dies kann durch matte, nicht reflektierende Materialien umgesetzt werden. Sitzmöbel sollten sich in der Farbgebung kontrastreich vom Boden absetzen. Hierdurch wird vermieden, dass Sie für Menschen mit Seheinschränkungen zur Stolperfalle werden.
Und … Ich könnte meine Ausführungen an dieser Stelle natürlich noch vertiefen, allerdings würde alleine das Thema der Behindertentoiletten mehrere Seiten füllen. Daher möchte ich mit meiner Aufzählung der Möglichkeiten der barrierefreien Gestaltung von Räumen hier in diesem Rahmen enden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kurzen Aufriss verdeutlichen, wie weitreichend und umfangreich das Thema ist und dass doch viele Dinge dazu gehören, die man im ersten Augenblick nicht bedenken würde. Es gibt natürlich gesetzliche Grundlagen und Richtlinien, wie die Landesbauordnung oder die DIN 18040-Teil 1, welche die wesentlichen Vorschriften für die Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden enthalten.
Tipp: Broschüre barrierefreies Bauen
Wenn Sie an der Umsetzung von Barrierefreiheit in Ihrer Einrichtung interessiert sind, möchte ich Sie gerne auf eine Broschüre der Agentur für Barrierefrei NRW aufmerksam machen. Diese enthält neben den schriftlichen Erläuterungen auch Bilder von Lösungsbeispielen, die der Veranschaulichung sehr dienlich sind:
Broschüre: barrierefreies Bauen (Agentur Barrierefrei NRW)