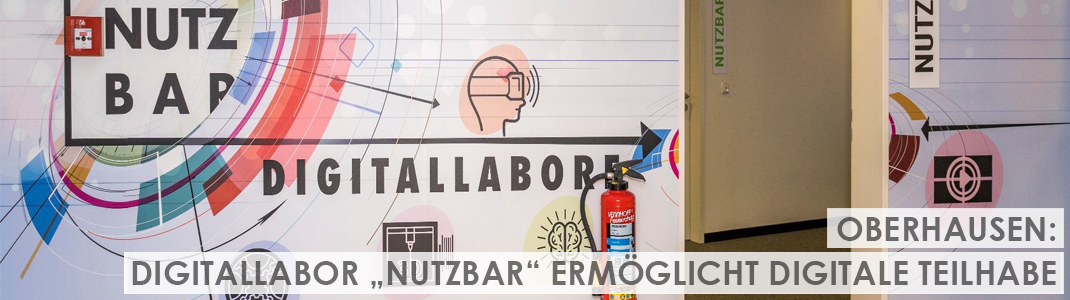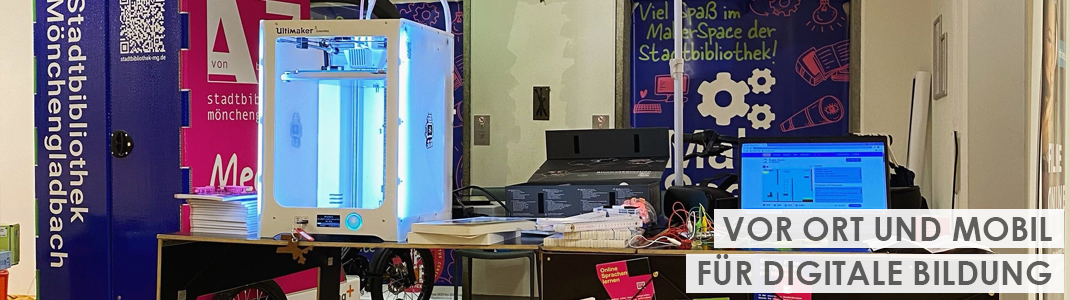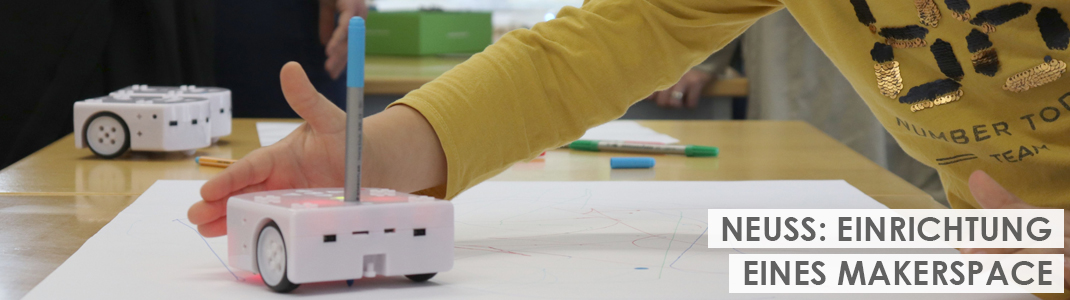Im November 2021 wurde direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof nach fast dreijähriger Bauzeit die neue „Zentralbibliothek im KAP1“ der Stadtbüchereien Düsseldorf eröffnet. Mit dem Ziel, dass die neue Zentralbibliothek mit ihren Angeboten die Bedürfnisse und Erwartungen der Besuchenden an Self Services und technischer Ausstattung antizipiert, erfüllt bzw. übertrifft, wurde eine ganze Reihe an Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Darunter ist die Einführung eines ganzen Pakets an neuen digitalen Self Services, die in den Jahren 2020 bis 2023 mithilfe der Landesförderung umgesetzt werden konnten. Sie machen den Aufenthalt in den Bibliotheksräumen zu einem Erlebnis, und verbessern die Kundenkommunikation in einer Bibliothek mit ausgeweiteten Öffnungszeiten. Alle Maßnahmen sind dabei eingebettet in eine alle Aktivitäten der Zentralbibliothek einschließende, umfassende Digitalstrategie.
Bereits 2019 wurde ein Vorprojekt durchgeführt: „Digitalstrategie für die Zentralbibliothek in KAP1 2021 – Gründung Expertengruppe“ Hier wurden in einem mehrmonatigen moderierten Prozess und unter Beteiligung einer Gruppe aus Fachleuten, die im Folgeprojekt umzusetzenden Bestandteile ermittelt und in ihrer beabsichtigten Ausprägung festgelegt. Die Arbeitsgruppe setzte sich zusammen aus Bibliotheksteam, Fachstelle und Expert*innen in den Bereichen AR/VR, App-Entwicklung, Kundenservice, Anfragemanagement und Kommunikation.
Dabei stand besonders im Fokus, durch Digitalisierungsmaßnahmen die „Self-Services“ zu verbessern. Insbesondere durch die damals geplante und seitdem erfolgreich umgesetzte massive Erweiterung der servicefreien Öffnungszeiten („Open Library“) in der Zentralbibliothek ab 2021 war dies ein Desiderat. Ebenso wurde mit einer immens gesteigerten Nutzung durch neue Kund*innen und Besucher*innen gerechnet. Die damals erhofften 1 Mio. Besuchende pro Jahr wurden in zwischen erreicht und übertroffen.
Der Gedanke bei allen Maßnahmen: Auch während der servicefreien Zeiten sollen die Besucher*innen ein umfassendes, positives Serviceerlebnis in der Bibliothek haben. Die Verbesserungen sollten zum einen durch Veränderungen der internen Organisation sowie der Beschaffung von Hilfsprogrammen und technischer Infrastruktur realisiert werden. Die neue Zentralbibliothek im KAP1 sollte zum anderen auch als Ort Bibliothek mit digitalen Erlebnissen überzeugen. Die Besucherinnen und Besucher würden erwarten, dass die Bibliothek nicht nur mit aktuellen gängigen digitalen Services (wie freies WLAN, E-Payment etc.) ausgestattet ist, sondern auch digitale Anwendungen im Raum bietet, die begeistern und die die Bibliothek als (digitalen) Ort erfahrbar machen.
Die Bausteine des Projekts:
- Digitalisierung und Neuorganisation des Beschwerde Managements (Chatbot, Ticketing-System, interne Umorganisation)
- Ausbau der Einsatzzwecke des humanoiden Roboters Pepper (Integration von Chatbot, Weiterentwicklung des Funktionsumfanges)
- Digitale Organisation und Erlebnisse im Raum Bibliothek (Raumbuchungssystem, Tablet-Dispenser, Mobile Device Management)
- Entwicklung einer Bibliotheks-App (Navigation und Orientierung mithilfe von AR, Hinweise auf Veranstaltungen, Vernetzung von Bibliotheksbesuchenden)
Digitalisierung und Neuorganisation des Beschwerde Managements und der Kundenanfragen
DigiAuskunft mit Ticketsystem
Kund*innenanfragen gehen bei der Zentralbibliothek dezentral ein. Die Ausgangssituation: Telefonische Anfragen erreichten die Serviceplätze im Publikumsdienst, Mailanfragen gingen über verschiedene, nicht immer die zuständigen, (Funktions-)Adressen an verschiedene Personen und mussten von dort aufwändig umverteilt werden. Das hatte eine Vielzahl von notwendigen Absprachen zur Handhabung der Verteilungswege und zur Folge und war dementsprechend – vor allem bei komplexen Anfragen – für die Anfragenden mit Wartezeiten verbunden. Zudem konnte immer wieder festgestellt werden, dass während der Publikumszeiten an der Theke eingehende Anrufe ein Stressfaktor waren und während laufenden Kundengesprächen nicht angenommen werden konnten.
Die Einführung des Ticketsystems der DigiAuskunft konnte im Rahmen des Projekts erfolgen und war deshalb der erste Schritt zur Verbesserung dieser Situation. In einer Testphase wurde das Tool zunächst vom Sachgebiet Digitaler Kundenservice und Fernleihe in den Arbeitsalltag integriert und nach erfolgreicher Testphase Schritt für Schritt an die Kolleg*innen vermittelt.
Hotline
Die erfolgreiche Einführung dieses Werkzeugs war entscheidend für die Umsetzung des nächsten Schritts: die Umorganisation der internen Prozesse einschließlich der Einführung einer Hotline. Neben der Besetzung von Theken und Sortierraum kümmert sich seit der Eröffnung jeweils eine Person um die Hotline. Hier gehen alle allgemeinen Anrufe und Mails ein und werden beantwortet oder, falls keine direkte Beantwortung möglich ist, per DigiAuskunft in ein Ticket umgewandelt. Ebenso liegt hier die Aufgabe, in den Funktionsordnern eingehende Anfragen zu sichten und umzuverteilen.
Der Hotline-Platz ist analog zu der Struktur der Thekeneinsatzzeiten zu jeder Stunde der Öffnungszeit, die mit Servicepersonal ausgestattet ist, von einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Fachangestellten-Team besetzt. Dies entspricht 51 Stunden, in denen die eingehenden Anfragen von einer eigens dafür zuständigen Person bearbeitet werden. Dabei kann die Hotline von jedem beliebigen Arbeitsplatz aus bedient werden. Die DigiAuskunft ist damit der zentrale Zugriffspunkt für die interne Bearbeitung von eingehenden Anfragen geworden; insbesondere in Querschnittsfragen, bei Anfragen, die eine Rücksprache mit anderen Einheiten oder ein Nachfassen erfordern, konnte mit diesem Tool eine spürbare Arbeitserleichterung für alle beteiligten Kolleg*innen erreicht werden und der Vorgang der Bearbeitung transparent, nachvollziehbar und geradlinig gestaltet werden.
Der Übergang zum neuen System verlief ohne Schwierigkeiten und wurde von allen Kolleg*innen erfolgreich aufgenommen. Die Schnelligkeit bei der Beantwortung der Anfragen hat spürbar zugenommen; seit September 2021 werden final alle Funktionspostfächer, die für externe Anfragen offen sind, erfolgreich und ohne Probleme mithilfe der DigiAuskunft bearbeitet.
Chatbot: Bisher 122 Antworten mit je 25 Fragevarianten
Mit dem Angebot „Frag Düsseldorf“ wurde 2019 auf der Basis von Botpress ein Chatbot als interaktives Hilfsmittel für das Digitale Amt der Landeshauptstadt und zur Beantwortung von Verwaltungsanliegen eingeführt. Diese bestehenden Strukturen konnten die Stadtbüchereien Düsseldorf nutzen und eine eigenständige Instanz auf der Grundlage der verwendeten Software einrichten lassen, mit der Absicht, einen speziell angepassten mit KI selbstlernenden Bibliotheks-Chatbot aufzubauen.
Der zwischenzeitliche Wechsel zu einem anderen Bot des Anbieters bedingte es, dass das Projektteam schließlich mit einem Bot arbeiten musste, der hinter den ursprünglichen Erwartungen an den Funktionsumfang und die KI-Funktionen deutlich zurückblieb. Im Ergebnis stand die Herausforderung, den Chatbot inhaltlich so zu befüllen, dass er als hilfreiches Instrument einsatzfähig wurde und Strategien zu entwickeln, wie das Wegfallen der Selbstlern-Fähigkeit durch das Team kompensiert werden könnte.
Ziel war: der Bot sollte zur Beantwortung einer möglichst großen Anzahl an Fragen dienen. Da die initiale Befüllung des Systems mit Wissen und das weitere Training auf der Basis eingehender Fragen manuell erfolgt, wurde eine Strategie entwickelt:
Die Voraussetzung für das richtige Verstehen einer Frage ist, dass die Frage mit einer vorher trainierten Frage oder mit einem Schlagwort übereinstimmt. Als erster Schritt wurde eine Fragensammlung veranlasst: der Bot wurde den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt, mit der Bitte, ihn aus ihrer Sicht mit Fragen zu „füttern“. So wurde ein großer Pool an möglichen Fragen, Formulierungen, Frageformen, Begriffsvarianten etc. im Bot erfasst und konnte im Content Management System von Botpress bearbeitet werden. Es wurden dann Themenkomplexe ermittelt und geclustert, um passende Antworten zu verfassen. Diese wurden so gestaltet, dass mit möglichst wenigen umfassenden Antworten eine möglichst große Anzahl an Fragen beantwortet werden kann. So können möglichst viele Fragen im Bot eine zufriedenstellende Antwort erhalten und die spätere Bearbeitung und Erweiterung wird erleichtert: Bei neu eingehenden und noch nicht erfassten Fragen können diese effizienter einer Antwort zugeordnet werden. Gleichzeitig wurden überall dort, wo es um Detailinformationen zu unseren Angeboten geht, ein Link eingebunden, der an die entsprechende Stelle auf der Stadtbüchereien-Webseite oder zu einer E-Mail-Adresse weist. Es sind in diesem Modus 122 umfassende Antworten erfasst worden, wobei jede auf bis zu je 25 Fragevarianten reagiert.

Alle im Bot eingehenden Fragen können vom Projektteam im laufenden Betrieb über das Backend gesichtet werde. So wird ständig kontrolliert, ob Antworten korrekt sind, ob es neue Fragen gibt oder ob Formulierungen missverstanden wurden. Mit der regelmäßigen Bearbeitung und Korrektur in diesem „Misunderstood“-Modul des CMS wird so langfristig eine Erhöhung der Antwortqualität und der inhaltlichen Abdeckung erreicht.


Der Chatbot ist in der erarbeiteten Form innerhalb der Stadtbüchereien Düsseldorf App veröffentlicht und wird stetig weiterbearbeitet und verbessert, um perspektivisch dem ursprünglich anvisierten Nutzungserlebnis nahe zu kommen.
Digitale Organisation und digitale Erlebnisse im Raum Bibliothek
Hublets ermöglichen Vor-Ort-Nutzung digitaler Angebote der Bibliothek
Eine neue Bibliothek wird noch attraktiver durch eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Angebote zu nutzen. Insbesondere die Verbindung von physischem und digitalem Angebot sollte im neuen Haus stärker in den Fokus rücken und die Sichtbarkeit und Erlebbarkeit der digitalen Medien verbessert werden. Hierfür wurden Dispenser für die Inhouse-Ausleihe von Tablets angeschafft.
Für die Zentralbibliothek Düsseldorf erwies sich hier das Produkt Hublet als das Gerät der Wahl, sowohl was Administration, Sicherung, Datenschutz, Design und Kosten angeht. Sechs Stationen á sechs Tablets stehen nun zur Verfügung und bieten an verschiedenen Stellen in der Bibliothek die Möglichkeit, mit der Bibliothekskarte ein Gerät zur Nutzung innerhalb der Räume auszuleihen. In der dreistündigen Ausleihzeit können Kund*innen mit den Geräten die digitalen Angebote der Stadtbüchereien und ausgewählte Webseiten nun auch vor Ort mobil nutzen. Ein Administrationsportal erlaubt es dem Team, die Apps und Links, die zur Nutzung angeboten werden, flexibel selbst zu verwalten.

Raumreservierung
Die Anforderungen an ein Raumreservierungssystem waren vielfältig: Zum einen sollten die Veranstaltungsbereiche in der Zentralbibliothek so reservierbar sein, dass das Team der Veranstaltungskoordination Räume und Technik so freigeben kann, dass Zuordnung und Verfügbarkeit leicht und übersichtlich sind. Zum anderen sollten die Lernboxen der Zentralbibliothek extern von Kund*innen mit Bibliothekskarten online reservierbar sein, intern und vor Ort aber auch von Kund*innen ohne Bibliothekskarte. DAs System EVENT-IS erfüllte alle Voraussetzungen an den benötigten komplexen Funktionsumfang und die Anbindung an das Authentifizierungssystem. Das System ist Teil der Stadtbüchereien App und unter https://raumbuchenkap1.de/ sichtbar.
Mobile Device Management zur einheitlichen Verwaltung aller mobilen Geräte
Die Organisation der bibliothekseigenen Laptops und Tablets erfolgte bislang durch die verwendenden Organisationseinheiten bzw. Personen jeweils im Einzelzugriff und mit einer Vielzahl von Accounts. Im Rahmen des Projekts konnte hier das Produkt Miradore lizenziert werden. Vorgabe war ein Tool, das sowohl Android, als auch iOS-Systeme, als auch Windows-Systeme administrieren kann, um die Bandbreite der Publikumsgeräte abzudecken.
Bei der Marksichtung lag das Hauptaugenmerk auf den erforderlichen Funktionen, die Bedienfreundlichkeit (damit es auch von Kolleg*Innen ohne Programmierkenntnisse zu bedienen ist) und -aufwand sowie den Kosten. Das letztlich mit 200 Lizenzen angeschaffte Produkt Miradore ist mit Lizenzen für den Bildungssektor das, was die Anforderungen am besten abdeckt. Es wird genutzt, um System, Updates und Anwendungen der Geräte zu verwenden, die für Schüler*innen bei Recherchetrainings verwendeten werden (Notebooks), und die von Team Führungen und Medienpädagogik für Kund*innennutzung bei Veranstaltungen und Workshops verwendet werden.
Die Oberfläche ist komfortabel und lässt nach dem initialen Aufwand, alle Geräte zu erfassen, eine einheitliche und sehr viel effizientere Verwaltung aller Geräte zu.
Ausbau der Einsatzzwecke von Pepper
Der humanoide Roboter Pixi Pepper ist in der Zentralbibliothek ein Publikumsmagnet und ein wirksames Instrument zum Imagewandel einer modernen Bibliothek. Als starkes PR-Instrument visualisiert der Roboter den digitalen Wandel und ist Anziehungspunkt im Erlebnisort Bibliothek, insbesondere für Kinder ist Pepper ein Magnet.

Eine Integration des Chatbots sollte zusätzlich dazu beitragen, Pixi Pepper auch zur intelligenten Auskunftsperson zu machen. Eine Schnittstelle zur Implementierung des Systems Chatbot ist gemäß Leistungsumfang grundsätzlich vorhanden, allerdings konnte im Projektzeitraum keine Abstimmung zwischen den Dienstleistern der Systeme von Chatbot und Pepper erreicht werden. Eine Aktivierung der Sprachsynthese für die Nutzung des Chatbots über den Roboter konnte entsprechend nicht eingerichtet werden, so dass dieser Punkt noch in Arbeit ist. Eine Beschädigung des Roboters durch Nutzende im Raum der Bibliothek und die darauffolgende mehrmonatige Reparatur führte ebenfalls zu Verzögerungen. Die Verfügbarmachung des Chatbots auf dem Roboter ist trotzdem weiterhin aktives Ziel und wird umgesetzt, wenn eine fehlerfreie Implementierung möglich ist.
Entwicklung einer Bibliotheks-App
Die Entwicklung einer Bibliothek-App war bei der Gestaltung neuer und zeitgemäßer digitaler Self-Services ein zentrales Element in der Strategie der Stadtbüchereien Düsseldorf. Wesentliche Leitlinien waren das Grundprinzip „Hier und Jetzt“, die Zielgruppe „Mainstreamer“, ein innovativer Charakter des Angebots, die Anwendung neuartiger Technologie und die Datensparsamkeit. Obligatorisch ist die Bereitstellung für alle gängigen Betriebssysteme über App Store und Google Play Store. Die „Stadtbüchereien Düsseldorf App“ wurde am 14./15. Dezember 2022 in den beiden Stores veröffentlicht und ist seitdem in der Zentralbibliothek im KAP1 der Stadtbüchereien Düsseldorf im Einsatz.

Das Grundprinzip der App ist „Hier und Jetzt“. Sie konzentriert sich in ihren Kernfunktionen auf den Raum Bibliothek und soll seine Nutzung im Moment des Aufenthalts erleichtern – sie stellt die Bibliothek als „Dritten Ort“ in den Vordergrund. Vor dem Hintergrund eines mit dem Umzug der Bibliothek deutlich vergrößerten Raums (8000 m² Publikumsfläche) und Open Library-Öffnungszeiten, in denen Besuchende ohne Personal auskommen, wird ein Instrument zur Verfügung gestellt, das das Auffinden von Themen, Regalen und Räumen mit dem eigenen Mobilgerät möglich macht („das Leitsystem in der Hosentasche“). Gleichzeitig bietet die App mit einer Vernetzungsfunktion eine soziale und Kommunikationskomponente an.
Die Grundfunktionen der Anwendung:
- Orientierung und Navigation im Raum
- Aktivitäten: Begegnen und Kommunizieren
- Animationen: Entdecken und Erleben
All diese Funktionen werden mit Augmented Reality umgesetzt. Mithilfe dieser Technologie wird eine Umgebung, betrachtet durch die Kamera des Mobilgeräts, mit Computerelementen verbunden und mit diesen angereichert. Für die Stadtbüchereien App bedeutet das: Blickt man durch die Handykamera in den Raum der Zentralbibliothek, werden zusätzliche Informationen wie Navigationspfeile oder Animationen über das Kamerabild eingeblendet. Die virtuellen Elemente sind an den jeweiligen Kontext angepasst: an verschiedenen Orten im Raum gibt es unterschiedliche Animationen oder bewegte 3D-Bilder; der Verlauf der Navigationspfeile, die einem den Weg zu bestimmten Punkten weisen können, ist dem jeweiligen individuellen Aufenthaltspunkt bzw. Startpunkt angepasst.
Ergänzt werden die Kernfunktionen durch Zugänge zum Raumreservierungssystem, zum Chatbot und zu den Veranstaltungen in der Zentralbibliothek. Als weitere Funktionen bietet die App einen Raumplan der Zentralbibliothek mit Signaturgruppen und Liste mit den Standorten der Zweigstellen mit Link zur bevorzugten Karten-App.
Die AR-Kernfunktionen sind ausschließlich in den Räumen der Zentralbibliothek zu nutzen und können auch nur dort aktiviert werden. Alle weiteren Funktionen, die Nutzende im Menü finden, sind auch außerhalb der Räume zu nutzen.
Die neu entwickelte App ist bewusst keine Variante oder andere Darstellung der Stadtbüchereien-Homepage, des Katalogs oder von Kontofunktionen. Für all dieses gibt es bereits Anwendungsformen – die App ist eigenständig und fokussiert auf ihre Spezialfunktionen.
Grundlagen: 3D-Modell der Bibliothek und Lokalisierung
Um Feststellung des Aufenthaltsortes im Raum und Darstellung der AR-Elemente an den richtigen Punkten zu ermöglichen, arbeitet die App mit Indoor-Navigation und einem digitalen 3D-Modell der Bibliothek; dies ermöglicht ein hohes Maß an Genauigkeit und ist äußerst datensparsam.
Die umsetzende Firma Exponential Dimensions erreichte dies mit einer neuartigen Methode, Innenräume digital zu erfassen und diese Daten anschließend für Navigation und Orientierung zu nutzen. Die Größe der Bibliothek mit einer Publikumsfläche von 8000 m² war hier eine besondere Herausforderung und erforderte ausgiebiges Testen, zumal diese Methode in Räumen dieser Größe bisher nicht zur Anwendung kam.
Im Ergebnis ist die App in der Lage, sich bei der Feststellung des genauen Aufenthaltsortes des verwendeten Geräts an den digital erfassten räumlichen Gegebenheiten (bauliche Strukturen wie Säulen, Treppen, taktiles Leitsystem etc.) und an festen Einrichtungsgegenständen (z.B. Regale, Infotheken, Rondell im Lesefenster o.Ä.) zu orientieren. Damit dies möglich ist, wurde zunächst die gesamte Bibliothek mit speziellen Scangeräten in einem aufwendigen Verfahren eingescannt. Das verwendetet Verfahren benutzt Methoden der Fotogrammmetrie, um Objekte anhand von einer großen Anzahl von Fotos zu messen und digital zu rekonstruieren. Aus den Messdaten wurde anschließend ein digitales 3D-Modell der Bibliotheksräume erzeugt, das aus einer Vielzahl an Datenpunkten besteht und auf dem die Darstellung aller AR-Informationen in der App basiert. Als Programmierwerkzeug wurde das Software Development Kit Immersal SDK verwendet; dieses bildet die Basis der App, des photogrammetrischen Scans, der Erstellung des 3D-Modells einschließlich der Navigation und stellt die entsprechenden Funktionen bereit.
Jedes Gerät, das die App und die AR-Funktionen in den Räumen der Zentralbibliothek nutzen möchte, muss zu Beginn eine initiale Lokalisierung seiner Position vornehmen; das erfolgt über das Scannen eines von 22 App-Plakaten. Anschließend ist es möglich, alle AR-Funktionen zu nutzen und sich, z.B. vom Standort zu einem gesuchten Raum leiten zu lassen oder Animationen zu betrachten. Für Lokalisierung und Identifikation der Position des Geräts wird als technische Infrastruktur die Multiplayer-Engine des Herstellers Photon verwendet. Diese erlaubt es, über die Vergabe von anonymisierten IDs auf datensparsame Art das Verhältnis verschiedener Geräte entweder zueinander (bei der Funktion Aktivitäten) oder zu Räumen oder Animationen bestimmen.
AR-Kernfunktion Navigation
Die Navigationsfunktion ist ein zentrales Element der App. Hiermit erhalten Nutzende die Möglichkeit, sich zu den gewünschten Stellen in der Bibliothek leiten zu lassen. Dies kann entweder über das Angebot eines bestimmten Raums erfolgen, der aus einer mit Bildern hinterlegten Übersicht auszuwählen ist, oder es kann eine Signatur oder ein Themenbereich gewählt werden, woraufhin die App zum entsprechenden Ort navigiert.
Die navigierbaren Bereiche und Themen speisen sich dabei aus den AIgnaturen und Inhalten der Klassifikation und wurden mithilfe der Kolleg*innen des Lektorats überprüft. Die Prämisse war hier, die Kundensicht und „Kundenbegriffe“ zu verwenden. Zur Anpassung und zur nachträglichen Bearbeitung der hinterlegten Begriffe hat das Team Zugriff auf ein webbasiertes Verwaltungsportal. Die Suche nach Signaturen stellt sich für Nutzende insbesondere bei der Größe der neuen Bibliothek als hilfreich dar und kann die verfügbare Beschilderung und das Leitsystem sinnvoll ergänzen.
Zusätzlich zu der freien Eingabe mit Suchvorschlägen und Auswahl über eine bebilderte Liste, erschien es sinnvoll – dies wurde auch im Test mit verschiedenen Gruppen und Gremien deutlich – im unteren Screen-Bereich ständig die Navigation zu zentralen Orten wie WC, Aufzug, Kopierer, Scanner und Katalogrechner anzubieten. Dies ist realisiert worden und kann jederzeit ausgewählt werden.
Bei aktiver Navigation wird auf dem Gerätebildschirm ein beweglicher Pfeil eingeblendet, der den Weg weist; als begleitendes Element führt ein Avatar des humanoiden Roboters Pixi Pepper die Nutzenden zum gesuchten Ort und teilt dort mit, dass man angekommen ist.

AR-Kernfunktion Aktivitäten
Die Funktion Aktivitäten erfüllt das Vorhaben, per App eine Möglichkeit der Vernetzung zu schaffen und den Ort der Bibliothek als Treffpunkt zu beleben, Kommunikation zu befördern und aktiv Netzwerke schaffen zu können. Hiermit hat jede*r Nutzende die Möglichkeit per App ein eigenes Gesuch oder Angebot in den Raum der Bibliothek zu setzen und sich für andere damit sichtbar und erreichbar zu machen. Das könnte z.B. die Suche nach einem Schachpartner, der Suche nach Lernpartner*innen oder der Wunsch nach Austausch zu einem aktuellen Buch sein.
Die Eingabe des eigenen Gesuchs erfolgt über ein Formular in der App, ebenso können über eine Liste die derzeit laufenden Aktivitäten erkundet werden. Über den Handy-Bildschirm wird über Personen mit laufender Aktivität ein blauer Diamant eingeblendet (Augmented Reality), so dass auch hierüber eine Sichtbarkeit gewährleistet ist.
Im Hintergrund dieser Funktion ist eine Blacklist hinterlegt, die die Verwendung von Wörtern und Begriffen in dieser Funktion ausschließt. Zusätzlich hierzu gibt es für alle Nutzende die Möglichkeit, auffällige Aktivitäten zu melden. Diese Meldung erreicht dann per Mail das Verwaltungsteam der App, das anschließend über das Sperren der Aktivität entscheiden kann. Gleichzeitig können über das zur Verfügung gestellte Verwaltungsportal auch ohne Nutzung der App alle aktiven Aktivitäten auf Titel und Inhalt geprüft werden.
Das Team hat dort auch die Option, eigene Veranstaltungen und Aktivitäten im Bereich des Bibliotheksraums als solche in der Funktion zu erfassen und sichtbar zu machen.
AR-Kernfunktion Animationen
Ein Teil des App-Erlebnisses sind nicht nur funktionale Einheiten, sondern auch das Erlebnis- und Überraschungsmoment, das die Bibliothek zu einem noch besondereren Ort macht. An verschiedenen Stellen der Zentralbibliothek finden Nutzende beim Rundgang mit der App Augmented Reality Animationen und zusätzliche Informationen: ein Sonnensystem im Eingangsbereich, der fließende Rhein und ein Wald mit Tieren in der Kinderbibliothek, oder ein schmetterlingsumschwärmter Baum im Lesefenster. Diese tragen dazu bei, das spielerische Element der App zu betonen und laden ein, die Bibliothek zu erkunden und nach weiteren Animationen zu suchen. Auch bieten sie für Personen, die bisher noch nicht mit der Technologie vertraut sind, die Option, sich in vertrauter und geschützter Umgebung mit den Möglichkeiten bekannt zu machen. Bei Kindern wirkt das Element besonders, um die Bibliothek in Gänze zu durchlaufen, ältere Menschen gibt es eine Vorstellung vom innovativen Charakter des Hauses.
Zur Vermittlung eigener Dienste oder für andere Informationen beinhalten die AR-Animationen auch die sog. Panels an drei Stellen der Bibliothek. Das Team kann die Inhalte dieser Informations-Plattformen über das Verwaltungsportal eigenständig bestimmen und verändern. So gibt es beispielsweise auf dem Panel bei den Publikumszeitschriften die Möglichkeit, aus der App heraus die digitalen Angebote zu erkunden. An anderen Stellen werden Inhalte zu gerade laufenden Ausstellungen vermittelt oder das Veranstaltungsprogramm in der App zum Download angeboten. Auf den Panels wird der Inhalt je nach Bedarf hinzugefügt, so dass gezielt auch Vermittlungsdienste und Informationenangeboten werden können.

Weitere Funktionen
Die Kernfunktionen der App sind direkt auf dem Hauptscreen sichtbar. Alle weiteren Funktionen können über das Menü aufgerufen werden. Hier findet man neben dem Zugriff auf Raumreservierung und Chatbot auch die eigene Merkliste, die Einstellungen sowie Veranstaltungen, Raumübersicht und Übersicht der Büchereien.
Veranstaltungen:
Über diesen Menüpunkt ist eine Liste aller Veranstaltungen der Zentralbibliothek zu finden. Die Nutzenden haben hier die Möglichkeit, Favoriten zu setzen bzw. diese in der Funktion „Meine Merkliste“ zu speichern; diese Speicherungen bleiben solange in der App erhalten, bis sie aktiv gelöscht werden bzw. die App-Daten gelöscht werden. Die Speicherung erfolgt ausschließlich auf dem eigenen Gerät. Bei Veranstaltungen mit Anmeldung erhalten Nutzende die Option, direkt aus der App heraus eine vorgefertigte Mail über das Email-Programm ihrer Wahl zu senden.
Reservierungen:
Hier findet sich ein Link zum Raumreservierungssystem. Dieses öffnet sich in einem neuen Fenster.
Frag uns:
Hier befindet sich der Link zum Chatbot. Der Chatbot ist in der App nutzbar und in die App-Oberfläche integriert. Wie beim Raumreservierungssystem wird hier auf einen externen Dienst zugegriffen, der aber hier in der App-Optik erscheint. Der Chatbot wird zukünftig noch auf allen digitalen Präsenzen der Stadtbüchereien nutzbar sein und befindet sich im Lernstadium. Die Antworten werden sich im Laufe der Zeit immer weiter verbessern.
Meine Merkliste
In der Merkliste finden Nutzende eine Übersicht über die gemerkten/ favorisierten Veranstaltungen.
Ebenso findet man hier eine Übersicht über die eigenen „Aktivitäten“ und kann die einmal erstellten Gesuche nach Bedarf wieder aktivieren. Jede*r Nutzende kann damit die eigene Liste der präferierten Veranstaltungen und Aktivitäten speichern und verwalten.
Stadtbüchereien
Liste der Stadtteilbibliotheken mit Link zur jeweils genutzten Karten-App (z.B. Google Maps)
Vermittlung der App über alle Kontaktpunkte
Die App hat sich als ein wichtiges Instrument gezeigt, nicht nur, um Besuchenden eine bessere Nutzung der Räume und Services zu ermöglichen, sondern auch, um Teilhabe an Technologie und Hands on-Ausprobieren von Innovation betrifft. Damit Besuchende nicht alleine mit dem neuen Angebot sind, bietet das Team alle zwei Wochen eine Einführungsveranstaltung zum Thema an. Diese Taktik hat sich bereits bei vergangenen Einführungen neuer Dienste bewährt und wird in erster Linie von älteren Menschen wahrgenommen. Hier kommt es immer auch zu interessanten Gesprächen über aktuelle Angebote von Bibliotheken. Gerade, da die neue Zentralbibliothek auch nach eineinhalb Jahren des Bestehens weiterhin auch neue Besucherinnen und Besucher anzieht, vielfach auch Personen, die seit Jahrzehnten keine Bibliothek mehr benutzt haben, ist die App das optimale Mittel, den Charakter und die Wandlungsfähigkeit von Bibliotheken zu vermitteln und darüber ins Gespräch zu kommen.
Neben den Veranstaltungen steht während der Öffnungszeiten regelmäßig eine Kollegin im Eingangsbereich der Bibliothek, um über das neue Angebot zu informieren. Auch dies wird insbesondere von älteren Besuchenden in Anspruch genommen, die die Chance wahrnehmen, nicht nur die Bibliothek neu kennen zu lernen, als auch sich mit neuen Diensten vertraut zu machen.
Gelegentlich bekommt das Team es dabei auch mit der Erwartung zu tun, eine Bibliotheks-App biete in erster Linie eine inhaltliche Recherche an; bei Erklärung des Konzepts und der Idee der App stößt dies aber flächendeckend auf großes Verständnis, insbesondere, da diese Services ihre eigene Präsenz im Raum haben.
Insgesamt stellte sich die Entwicklung eines Angebots wie der App im Rahmen der Möglichkeiten und organisatorischen Grenzen der öffentlichen Verwaltung an vielen Stellen als große Herausforderung dar; im Ergebnis ist aber ein Angebot entstanden, das nicht nur das Selbstverständnis aktueller Bibliotheksarbeit symbolisiert, sondern auch für Besuchende ein überraschendes Nutzungserlebnis mit zahlreichen Funktionen bietet.
Die Vermittlung des neuen Angebots ist unerlässlich und muss – wie bei allen digitalen Angeboten, die nicht im Raum sofort sichtbar sind – aktiv und an allen Kontaktpunkten mit Besucherinnen und Besuchern erfolgen. Es ist hierbei immer hilfreich, auch Präsentationsmöglichkeiten wie eigene Geräte, Infoscreens und Präsentationsbildschirm zu nutzen und diese wechselnd mit Eindrücken der App zu bespielen.
Fazit: Neue digitale Services tragen zum Imagewandel einer modernen Bibliothek bei
Mit der Förderung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW konnten die Stadtbüchereien Düsseldorf mit dem Projekt entscheidende und richtungsweisende Bausteine zur Digitalisierung für die neue Zentralbibliothek im KAP1 umsetzen. Die neue Bibliothek profitiert sowohl durch die Modernisierung und Optimierung interner Arbeitsabläufe, vor allem aber aufseiten der Besucherinnen und Besucher, Kundinnen und Kunden, von zeitgemäßen digitalen Services – auch während „Open Library“-Zeiten.
Die Vielfalt der umzusetzenden Maßnahmen, vor allem aber die Bestandteile, deren erfolgreiche Umsetzung stark von externen Partner, anderen städtischen Ämtern, Einrichtungen, Prozessen in Verwaltungsstrukturen abhängt, haben sich – zumal in der Pandemie – als große Herausforderungen erwiesen und die Grenzen des unter diesen Umständen Machbaren aufgezeigt.
Dennoch ist es gelungen, mit den neuen digitalen Self Services insgesamt einen positiven Effekt für die Nutzung der neuen Zentralbibliothek zu bewirken.
In der Entwicklung der ineinandergreifenden Bestandteile hat das Expert*innenteam des Vorprojekts bereits weit vorausgedacht und Pioniergeist bewiesen, insbesondere in der Konzipierung der App. Dass dies gelungen ist, zeigt jüngst die Auszeichnung der Stadtbüchereien Düsseldorf App als „Best Consumer App“ bei den internationalen „Auggie-Awards“ – der weltweit anerkannteste Preis der VR-/AR-Branche.
Die Projektbestandteile tragen neben ihrem unmittelbaren Nutzen zu dem positiven Imagewandel, hin zu einer modernen und attraktiven Bibliothek, bei: Die umgesetzten digitalen Services machen deutlich, dass man als Bibliothek mit anderenorts Selbstverständlichem weiterhin überraschen kann.