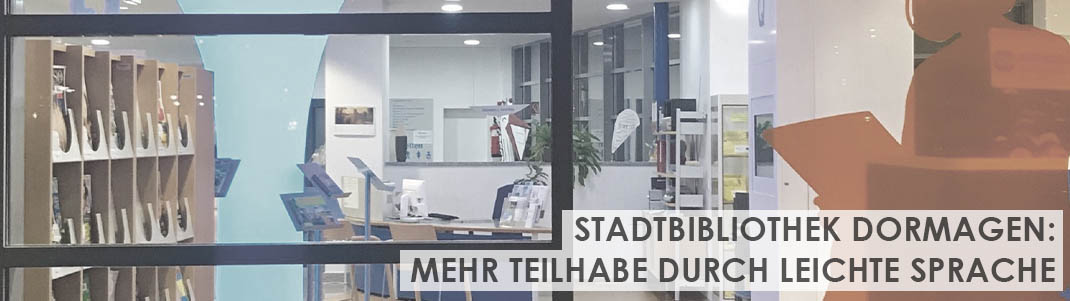Leichte Sprache soll Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe Kompetenz in der deutschen Sprache verfügen, das Verstehen von Texten erleichtern. Dazu gehören zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Sinneseinschränkungen wie Gehörlose oder Menschen mit geringen Deutschkenntnissen wie zum Beispiel Migranten. Es ist ein wichtiges Instrument für mehr gesellschaftliche Teilhabe und Barrierefreiheit. Insbesondere Bibliotheken können hier einen wichtigen Beitrag leisten wie das Beispiel der Stadtbibliothek Dormagen zeigt, die 2019 das Projekt „Leicht Sprache“ initiierte und sich mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen einer weiteren Zielgruppe geöffnet hat. Das Projekt wurde vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Landesförderung für Öffentliche Bibliotheken gefördert.
Die Stadtbibliothek Dormagen hat einen zusätzlichen Medienbestand in Leichter Sprache aufgebaut, der in unmittelbarer Nähe der Bereiche Sprache und Fremdsprachen sowie in der Kinder- und Jugendbibliothek präsentiert wird. Diese Angebote wurden auch in den elektronischen Katalog eingepflegt und auf diese Weise recherchierbar gemacht.
Außerdem wurden Bibliotheksmaterialien in Leichte Sprache übertragen. So hat das Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe im Rheinkreis Neuss ein Bibliotheksflyer in leichter Sprache_Dormagen erstellt – weitere Druckerzeugnisse in Leichter Sprache wie Briefe sind geplant.
Auch einzelne Seiten der Bibliothekshomepage wie Infos zum Bibliotheksangebot gibt es nun in Leichter Sprache – weitere sollen 2020 folgen: https://dormagen.de/index.php?id=3588

OPAC Stadtbibliothek Dormagen
Info-Bildschirm mit Multitouch-Display
Die Bibliothek hat einen Bildschirm mit Multitouch-Display aufgestellt. Er ermöglicht es, Informationen in Leichter Sprache auf vielfältige Weise zu präsentieren und Nutzerinnen interaktiv einzubeziehen. Durch die grafische Aufbereitung sowie eigenes Ausprobieren können die Kundinnen Informationen besser nachvollziehen und mit mehreren Sinnen erfahren und besser begreifen. Außerdem kann der Info-Bildschirm bei bibliotheksdidaktischen Aktivitäten unterstützen.

Der Multitouchscreen sowie der neue Info-Flyer sind auch Teil eines neuen Führungskonzepts, dass die Nutzung der Bibliothek in leichter Sprache erklärt.
Mission Inklusion: Lebenshilfe erklärt Handy-Welt
Im Mai vergangenen Jahres hat das Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe in der Stadtbibliothek eine kostenlose Handy-Beratung angeboten. Anlass war der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung unter dem Motto „Mission Inklusion – die Zukunft beginnt mit dir“. Erklärt wurden zum Beispiel die Anwendung von Diensten wie WhatsApp oder das Versenden von Fotos. Außerdem wurden auch konkrete Fragen zum Umgang mit dem eigenen Handy geklärt.
Im Anschluss erhielt jeder Teilnehmer den in Leichter Sprache erstellten Ratgeber „Handynutzung leicht gemacht“, der auch in der Bibliothek ausliegt. Die Tafel Dormagen e.V. unterstützte das Angebot mit Getränken und einem kleinen Snack. Aufgrund der großen Nachfrage wurde dieses Veranstaltungsformat im Februar noch einmal wiederholt und es ist angedacht, dies auch im Herbst 2020 wieder anzubieten.
Vortrag und Workshop für Multiplikatorinnen
Um auch Multiplikatorinnen aus der Stadtverwaltung mit hoher Kundenfrequenz wie beispielsweise Bürgeramt, Jugend- oder Sozialamt, aber auch die Mitarbeiter*innen des Kulturbereichs für das Thema zu sensibilisieren, fand im November 2019 ein Vortrag zum Thema Leichte Sprache mit anschließendem Workshop statt. Ein weiterer darauf aufbauender Workshop ist für 2020 geplant.
Fazit: Ein Mehrwert für die Bürger*innen und die Bibliothek
Alle im Rahmen des Projekts erstellten und angeschafften Medien erfreuen sich großer Beliebtheit und werden sehr gut nachgefragt. Dank des Projekts hat die Bibliothek mit dem Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe einen weiteren Kooperationspartner gewonnen, mit dem sie weitere gemeinsame Aktivitäten plant. Innerhalb der Stadtverwaltung Dormagen konnte sich die Bibliothek als Vermittler und kompetenter Dienstleister auf diesem Gebiet präsentieren und das Thema noch bekannter machen.
Über die Stadtbibliothek Dormagen:
Dormagen ist eine Mittelstadt im Rheinland, gelegen zwischen Düsseldorf und Köln mit derzeit etwa 65.000 Einwohner*innen, Tendenz steigend.
Die Stadtbibliothek Dormagen ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu einem Dritten Ort innerhalb Dormagens geworden. Er bietet den Einwohner*innen die Möglichkeit, sich an einem nicht-kommerziellen und wohnortnahen Ort aufzuhalten, um dort unterstützt von unserem Personal zu arbeiten, zu lernen, sich zu informieren, digitale Medien auszuprobieren, zu schreiben, Veranstaltungen zu besuchen oder auch zu kommunizieren und zu relaxen. Die Bibliothek bietet damit ein Ambiente, das von Menschen für bestimmte Aktivitäten offensichtlich gesucht wird. Als offenes, inklusives, interkulturelles und Generationen übergreifendes Angebot hat die Bibliothek dabei eine besondere Bedeutung innerhalb der Stadt Dormagen.
Die Stadtbibliothek Dormagen im Netz:
www.stadtbibliothek-dormagen.de
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/stabidormagen
https://www.instagram.com/stadtbibliothek_dormagen/
Ansprechpartnerin:
Claudia Schmidt
Stadtbibliothek Dormagen
Tel: +492133257211
E-Mail: claudia.schmidt@stadt-dormagen.de
Anschrift: Stadtbibliothek Dormagen – Marktplatz 1 – 41539 Dormagen