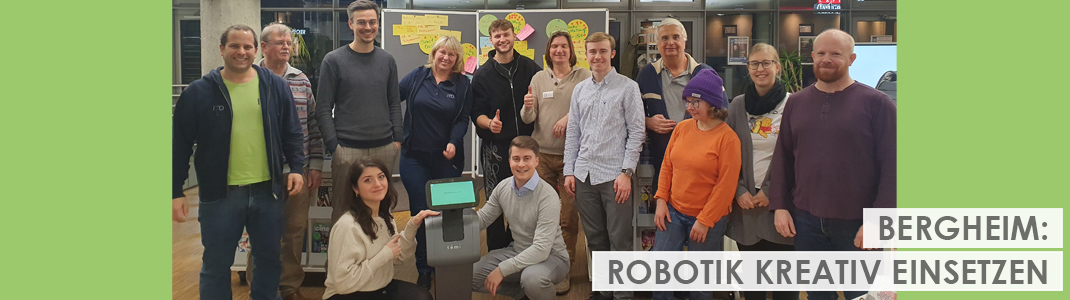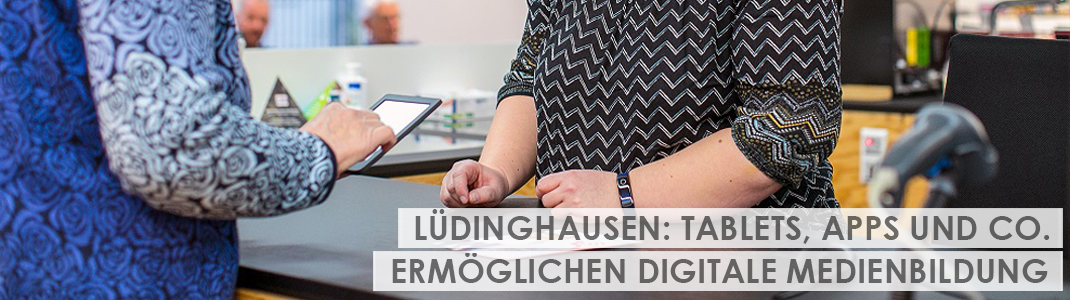Mit dem Landesprojekt „Bühne frei für Mensch und KI – Bibliothek als Kultur- und Informationszentrum“ hat die Stadtbibliothek Hennef einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Neue Technik, gezielte Fortbildungen und kreative Workshopformate stärken nicht nur die digitale Kompetenz des Teams, sondern auch die Rolle der Bibliothek als Ort der Begegnung, Bildung und kulturellen Teilhabe. Der folgende Bericht gibt einen Überblick über die Projektziele, den Ablauf, Herausforderungen und Erfolge – und zeigt, wie Bibliotheken auch in Zeiten von Künstlicher Intelligenz gesellschaftlich relevant bleiben. Das Projekt wurde vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Landesförderung für Öffentliche Bibliotheken gefördert.
Neue Technik – neue Möglichkeiten
Im Lesecafé wurde eine Bühne mit Vorhang, Scheinwerfern und Lautsprechern installiert. Vortragende profitieren nun von einer professionellen Tonanlage – ideal auch für musikalische Beiträge. Die Veranstaltungstechnik wurde in enger Abstimmung mit dem städtischen Techniker angeschafft. Außerdem gibt es nun einen Synthesizer, der individuell mit Kopfhörern als auch im Rahmen von Veranstaltungen genutzt werden kann.
Stärkung der Informationskompetenz
Das gesamte Bibliotheksteam erhielt eine Schulung zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Darüber hinaus bildete sich die Leitung zusätzlich fort und führte im Anschluss vier eigene Schulungen zu Künstlicher Intelligenz und Fake News durch. Die Stadtbibliothek wird seither stärker als Anlaufstelle für Informationskompetenz wahrgenommen.
Workshops für Jugendliche – gute Vorbereitung, geringe Teilnahme
Ein besonderer Fokus lag auf Angeboten für Jugendliche. Das Team wurde gezielt geschult, um entsprechende Workshops professionell vorzubereiten. Leider meldeten sich zu wenige Jugendliche an, sodass dieser Projektteil nicht die erhoffte Resonanz fand.
Kreatives Arbeiten im Team
Ein Workshop in Kooperation mit dem KKTheater Köln half dem Team, sich selbst neu zu entdecken: In gemeinsamer kreativer Arbeit wurden persönliche „Schätze“ gehoben und individuelle Stärken sichtbar gemacht. Das stärkte das Teamgefühl und schärfte den Blick für die eigene Rolle im digitalen Wandel.
Projektverlauf
Nach Projektgenehmigung Mitte des Jahres begann die Suche nach geeigneten Workshopangeboten.
Workshops & Veranstaltungen
- 29. August: Tobias Albers-Heinemann führte einen halbtägigen Workshop zur Künstlichen Intelligenz durch. Trotz der kurzen Zeit wurden zentrale Inhalte anschaulich vermittelt. Über die Plattform Erwachsenenbildung.digital konnte das Team anschließend weiterarbeiten.
- 18. & 19. September: Dr. Ruth zum Kley vom KKTheater besuchte die Bibliothek für jeweils vier Stunden. Gemeinsam mit dem Team entwickelte sie vier Workshopmodule, um Jugendlichen den Weg auf die Bühne mit eigenen Texten zu ermöglichen. Das Team schrieb eigene Texte und erprobte deren Präsentation auf der neuen Bühne.
Projektverlängerung & Umsetzung
Der Projektzeitraum wurde bis zum 28. Februar 2025 verlängert. In dieser Zeit lief die Öffentlichkeitsarbeit für:
- Jugend-Workshops („Wortkunst“)
- KI-Informationsveranstaltungen für Erwachsene
Leider nahmen am ersten „Wortkunst“-Termin nur zwei Jugendliche teil, weshalb die geplante vierteilige Workshop-Reihe nicht wie erhofft umgesetzt werden konnte.

Erfolgreiche KI-Schulungen für Erwachsene
Die KI-Einführungsveranstaltungen für Erwachsene fanden hingegen großen Anklang. Insgesamt gab es vier Termine:
22.01., 29.01., 05.02. und 26.02., mit jeweils 21 bis 28 Teilnehmenden, überwiegend über 60 Jahre alt.

Highlights der Veranstaltungen:
- Ein Dash-Roboter begrüßte die Gäste und regte erste Gespräche an („Ist der Roboter intelligent?“).
- Die Teilnehmenden schätzten analog ihre eigene KI-Kompetenz ein.
- Anschließend arbeiteten sie in Kleingruppen mit neu angeschafften iPads:
- Zeichnungen mit Quick, Draw!
- Song-Komposition mit KI
- Prompting mit ChatGPT
- Bildgenerierung mit KI
- Ein Deepfake-Video leitete zum Thema Fake News über. Ein Quiz forderte zum Erkennen echter vs. KI-generierter Fotos heraus.
- Die Veranstaltungen wurden niedrigschwellig und interaktiv gestaltet – mit analoger Evaluation per Chip in Ampelkisten. Fast alle Chips landeten im grünen Bereich.

Viele Teilnehmende waren überrascht, dass die Veranstaltung direkt in der Bibliothek stattfand – in persönlicher Atmosphäre und nicht im großen Saal der benachbarten Meys Fabrik.
Die Referentin verschickte im Anschluss eine Linkliste mit weiterführenden Materialien. Ein Büchertisch mit Sachliteratur und Romanen zum Thema KI begleitete die Veranstaltung. Viele Gäste waren zum ersten Mal überhaupt in der Stadtbibliothek.
Fazit
Das Projekt hat nicht alle Erwartungen erfüllt – insbesondere die Beteiligung Jugendlicher blieb hinter den Hoffnungen zurück. Dennoch brachte es zahlreiche neue Impulse, sowohl nach innen (Team, Technik, Kompetenzen) als auch nach außen (Wahrnehmung, neue Zielgruppen, Netzwerke).