
Die Fachstelle hat als Hilfestellung zur strategischen Ausrichtung der Bibliothek das Kommunikationsmodell „Bibliotheksfunktionen für eine digitale Gesellschaft“ entwickelt. Der Funktionsrahmen umfasst 5 Funktionen und unterstützt Bibliotheken, Politik und Verwaltung dabei, das Bibliotheksprofil für ihre Kommune in der digitalen Gesellschaft zu schärfen. Diese Funktionen sind:
- Ort für Wissen und Information
- Digitales Kompetenzzentrum
- Kultur- und Literaturort
- Ort für Inspiration
- Kommunaler Begegnungs- und Kommunikationsort
In 5 Blog-Beiträgen stellen wir Ihnen die einzelnen Bibliotheksfunktionen vor. Dabei wird zunächst die gesellschaftliche Relevanz der Funktion beschrieben (warum?). Dann wird der Inhalt skizziert (was?). Und schließlich gibt es Hinweise auf die notwendigen Ressourcen, die zur Umsetzung der Funktion in den Blick genommen werden sollten (wie?). Hier werden Anforderungen an Raum, Bestand, Technik und Mitarbeiterkompetenzen beispielhaft aufgezählt.

Teil 4: Macht (doch) was Ihr wollt: Bibliothek als Ort für Inspiration
Die gesellschaftliche Relevanz
In der Digitalen Gesellschaft verändert sich die Lernkultur. Neben dem schulischen Lernen rückt das lebensbegleitende Lernen und damit auch das individuelle und informelle Lernen immer mehr in den Fokus.
„….Lernen bedeutet Informationen zu teilen, zu kreieren, zu diskutieren und zu verknüpfen. Lernen bedeutet aktiv zu werden bzw. zu sein. Es setzt Neugier und Motivation beim Einzelnen voraus….“ Mit anderen Worten: Lernen braucht Inspiration und Anregung.
Bibliotheken sind seit jeher kommunale Lernorte. In ihrer Funktion als „Ort für Inspiration“ erweitern sie ihr Angebot als Lernort. Sie fördern Austausch, kreatives Gestalten und experimentelle Lernformen und leisten somit einen Beitrag zur kreativen Selbstentfaltung. Sie unterstützen das lebensbegleitende Lernen in all seinen Facetten und legen einen besonderen Fokus auf die Medienkompetenzförderung und das praktische Lernen.
Um der Schnelllebigkeit und dem steten Wandel, die die Digitalisierung mit sich bringt, erfolgreich zu begegnen, braucht es Kreativität und Spontanität. Mit ihren Angeboten als „Ort für Inspiration“ unterstützt die Bibliothek die Entwicklung kreativer Lernformen.

Was umfasst diese Funktion?
Die Bibliothek als „Ort für Inspiration“
- bietet Raum und Ausstattung für das freie und kreative Arbeiten und zum Sammeln neuer Erfahrungen mit analoger und digitaler Technik,
- führt regelmäßig Workshops und Einführungsveranstaltungen durch,
- bietet selbstorganisierten Lerngruppen Raum für Erfahrungsaustausch und gemeinsame Lernerlebnisse,
- ist mit ortsansässigen Akteuren und Bildungseinrichtungen vernetzt und arbeitet mit ihnen zusammen,
- ergänzt ihr Angebot an Kreativmaterialien und Ausstattung durch klassische Lernmedien,
- entwickelt ihr Angebot unter Beteiligung ihrer Nutzer*innen kontinuierlich weiter,
- ermöglicht es ihren Nutzer*innen, eigene Angebote in ihren Räumen umzusetzen.
Ressourcen: Anforderungen an Raum, Bestand, Technik und Mitarbeiterkompetenzen

Die aufgeführten Anforderungen an die Ressourcen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen. Zudem kann die konkrete Ausgestaltung einer Funktion für den jeweiligen Bibliotheksstandort nur unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen vor Ort erfolgen: dem jeweiligen Umfeld, dem politischen Gestaltungswillen und der Ressourcenverfügbarkeit.
Raum:
- Die Bibliothek verfügt über großzügige Öffnungszeiten, die auch durch eine Open Library erweitert werden können.
- Die Atmosphäre in den Räumlichkeiten inspiriert zur
kreativen Gestaltung. - Die Bibliothek verfügt über Ausstellungsmöglichkeiten für die in der Bibliothek hergestellten „Werke“.
- Die Präsentation der vorhandenen Materialien und Ausstattung lädt zur selbstständigen Nutzung ein.
- Die Bibliothek verfügt über genügend Unterbringungsmöglichkeiten (Schränke usw.) für Materialien
sowie analoge und digitale Ausstattungsgegenstände. - Die Bibliothek verfügt über ausreichende Flächen für alternative Lernformen (z.B. Makerspace, Werk- stätten, Probenräume, Spiel- und Gamingbereiche).
- Die Bibliothek verfügt über Nutzerplätze für verschiedene Funktionen.
- Der Raum ist soweit möglich schallgedämpft.
Technik:
- Die Kreativflächen verfügen über die auf die angebotenen Geräte abgestimmte technische Infrastruktur
(z.B. Steckdosen). - Die Bibliothek verfügt über qualitativ hochwertiges WLAN.
- Die Nutzerplätze verfügen über die für die jeweilige Anwendung erforderliche technische Infrastruktur.
- Die Bibliothek ist ggf. mit Open-Library-Technik ausgestattet.
Bestand:
- Ein Schwerpunkt des Medienbestandes liegt auf Literatur zur kreativen Gestaltung und spricht die vielfältigen Interessen der Bevölkerung an.
- Print-Anleitungen, E-Learning Tutorials und der Zugang zu Erklärvideos u.ä. unterstützen das kreative Lernen.
- Die „Bibliothek der Dinge“ kann Teil des Kreativangebotes sein.
Kompetenzen:
- Die Mitarbeiter*innen zeichnen sich durch hohe Recherche-, Informations- und Kommunikations- kompetenz aus.
- Die Mitarbeiter*innen sind in der Lage, Schulungsangebote selber zu entwickeln.
- Die Mitarbeiter*innen verfügen über bibliotheks- pädagogische Grundkenntnisse.
- Die Mitarbeiter*innen zeichnen sich durch hohe Vernetzungskompetenz aus.
Den kompletten Funktionsrahmen können Sie auch hier als pdf downloaden:
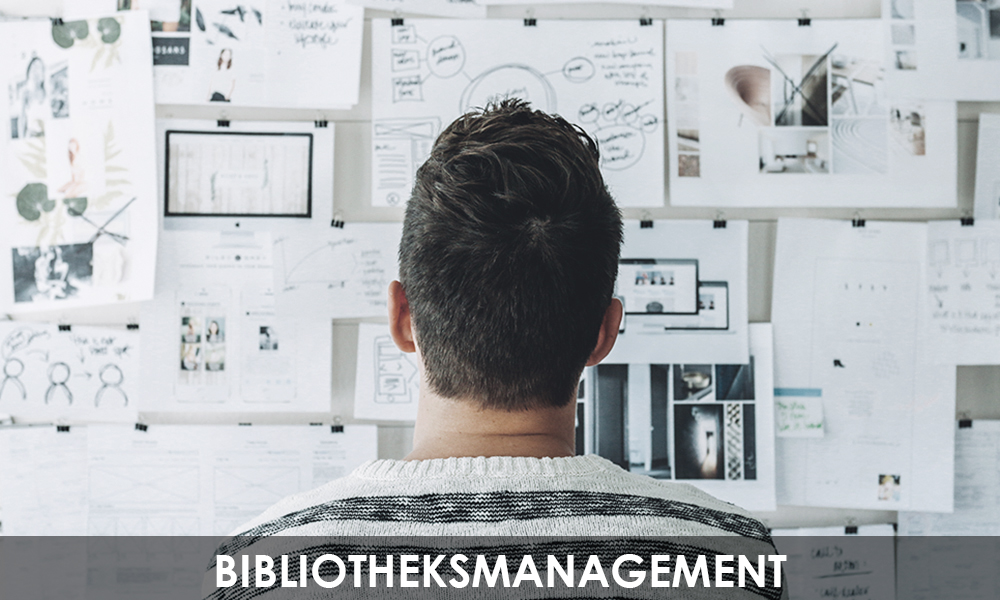







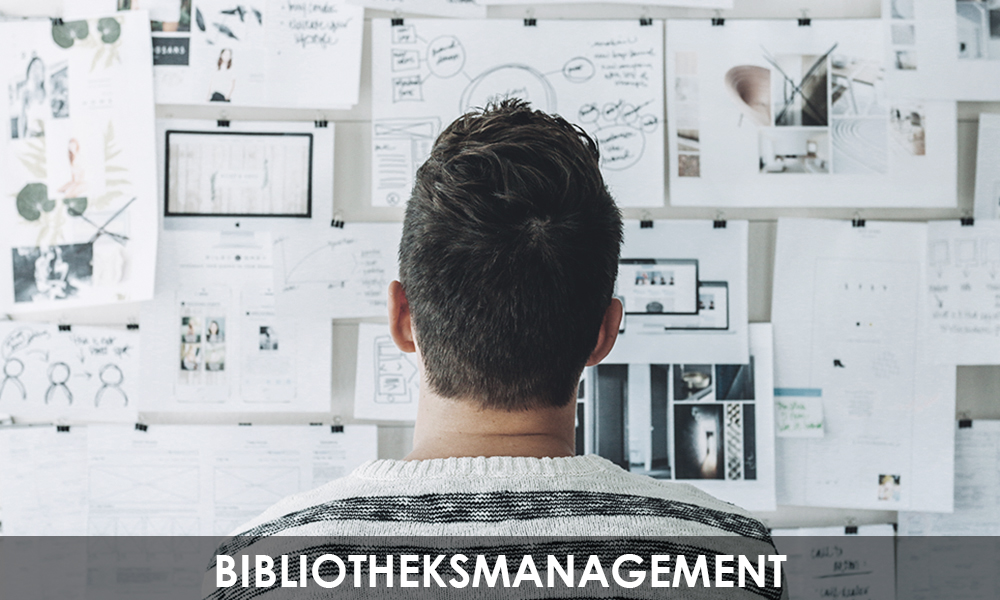



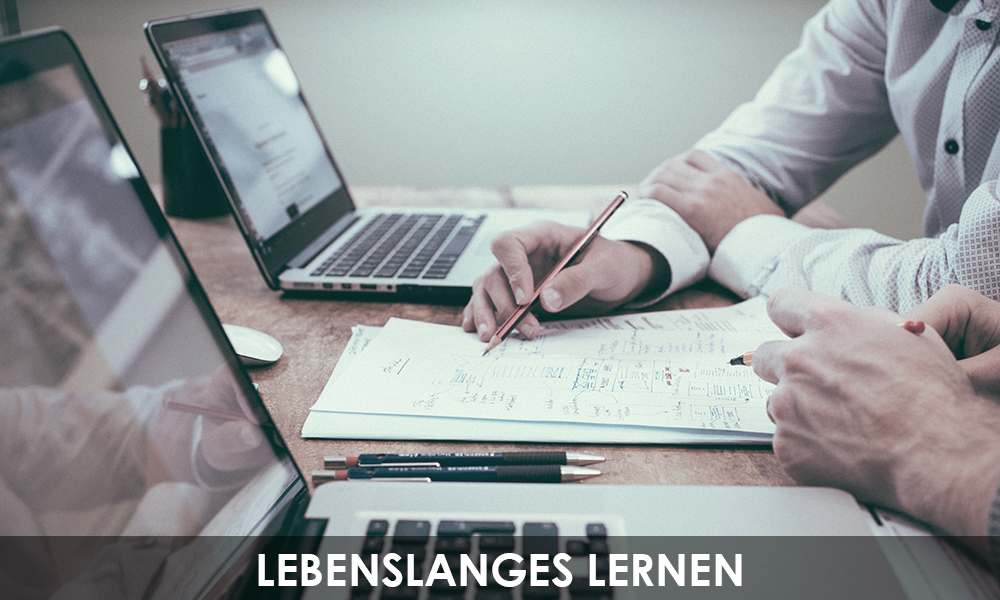




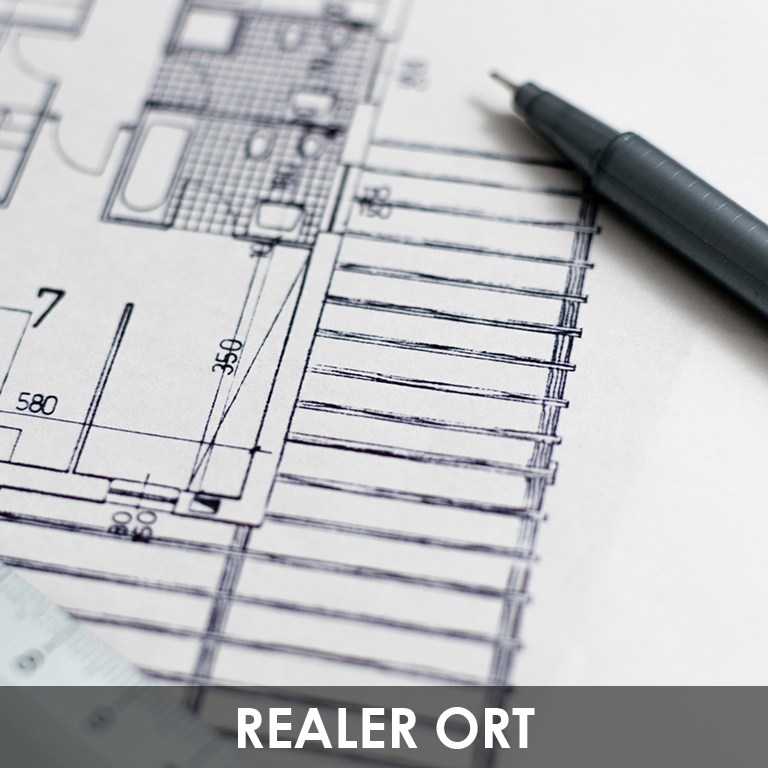

 Die übrigen Regeln waren schnell erklärt. „Wir erwarten einen respektvollen Umgang miteinander.“ Und – man höre und staune – es darf nicht laut werden (Ausnahmen bestätigen die Regel, wurde augenzwinkernd ergänzt. Zum Beispiel bei einer Klassenführung, wenn die Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal die Bibliothek erkunden. Dann dürfen sie 10 Minuten laut kreischend die unbekannten Räumlichkeiten durchstreifen). Jeder muss sich für die Bibliothek und ihre Einrichtung verantwortlich fühlen und pfleglich mit den Dingen umgehen. Womit man es allerdings nicht so genau nimmt, sind die Rückgabedaten für die entliehenen Medien. „Schließlich möchten wir, dass die Kinder sich wohl fühlen und sie nicht vertreiben. Die Bibliothek ist ihr Rückzugsgebiet, das nur ihnen zur Verfügung steht.“ Geduldig wird deshalb hinterher telefoniert, in der Regel mit Erfolg.
Die übrigen Regeln waren schnell erklärt. „Wir erwarten einen respektvollen Umgang miteinander.“ Und – man höre und staune – es darf nicht laut werden (Ausnahmen bestätigen die Regel, wurde augenzwinkernd ergänzt. Zum Beispiel bei einer Klassenführung, wenn die Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal die Bibliothek erkunden. Dann dürfen sie 10 Minuten laut kreischend die unbekannten Räumlichkeiten durchstreifen). Jeder muss sich für die Bibliothek und ihre Einrichtung verantwortlich fühlen und pfleglich mit den Dingen umgehen. Womit man es allerdings nicht so genau nimmt, sind die Rückgabedaten für die entliehenen Medien. „Schließlich möchten wir, dass die Kinder sich wohl fühlen und sie nicht vertreiben. Die Bibliothek ist ihr Rückzugsgebiet, das nur ihnen zur Verfügung steht.“ Geduldig wird deshalb hinterher telefoniert, in der Regel mit Erfolg.
 pro Jahr gibt es einen Themenschwerpunkt. Bei unserem Besuch stand das Thema „BiblioBotanic“ im Mittelpunkt. Die Themen werden ganzheitlich aufbereitet. So haben die Kinder zunächst unterschiedliche Pflanzen ausgesät und lernen die Früchte kennen. Anhand einer Landkarte verfolgen sie den Weg vom Anbaugebiet nach Oslo. U.a. wurden auch Kartoffeln in einem „Hochbeet“ gepflanzt. Und wie zufällig findet man überall Bücher zum Thema, die die Kinder durchblättern und natürlich auch ausleihen können.
pro Jahr gibt es einen Themenschwerpunkt. Bei unserem Besuch stand das Thema „BiblioBotanic“ im Mittelpunkt. Die Themen werden ganzheitlich aufbereitet. So haben die Kinder zunächst unterschiedliche Pflanzen ausgesät und lernen die Früchte kennen. Anhand einer Landkarte verfolgen sie den Weg vom Anbaugebiet nach Oslo. U.a. wurden auch Kartoffeln in einem „Hochbeet“ gepflanzt. Und wie zufällig findet man überall Bücher zum Thema, die die Kinder durchblättern und natürlich auch ausleihen können.


